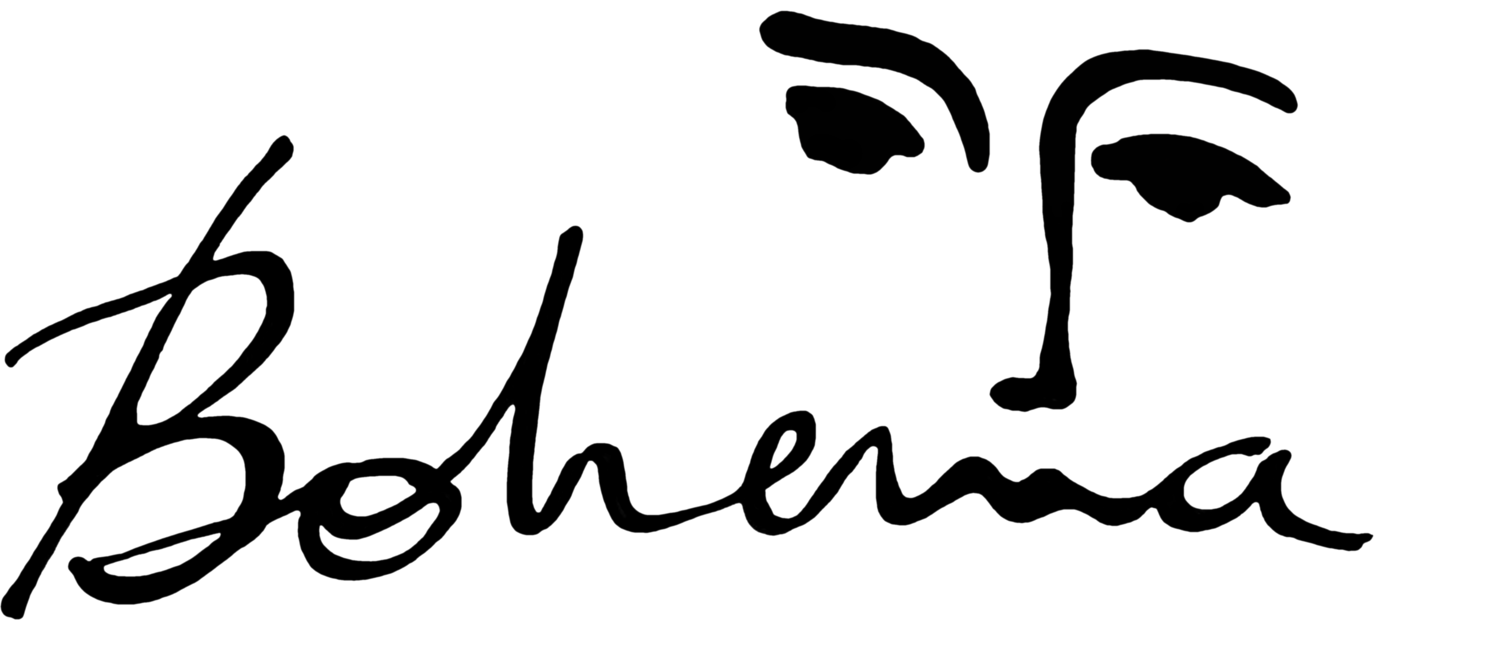Retrotopia - Satire aus der Zukunft, Texte aus der Gegenwart
Es zischt, brodelt und dampft: Retrotopia vom Institut für Medien, Politik und Theater verwandelt den häuslichen Herd in eine Bühne für politische Umerziehung. Zwischen Kochfeldern und einem Rolltisch trifft uns die Absurdität der Gegenwart.
Theaterlabor im Kosmos /// Bettina Frenzel ©
In der dystopischen Welt von Retrotopia ist das Gestern nicht bloß Erinnerung, sondern staatliche Direktive. Die Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern wird zur Ordnung erklärt und Abweichungen von der Norm mit sozialem Zwangsdienst bestraft. Schon geringfügige Vergehen reichen aus, um Frauen ins Umerziehungslager zu bringen, zum Beispiel ein Einsatz für Arbeitsrechte, ein versehentliches Gendern, ein queeres Liebesleben, ein Schwangerschaftsabbruch. Alles, was nicht ins reaktionäre Raster passt, gilt als Delikt. Als Strafe gibt’s unter anderem ein „mansplaining-training“, mein persönlicher Albtraum.
Doch Retrotopia ist kein Mahnmal, sondern eine Satire, die uns tragischerweise ans Jetzt erinnert. Das Stück springt von Tradwife-Content zum Druck der Konformität. Manche Figuren blieben stereotypisiert, die Handlung zeigte sich stellenweise vorhersehbar und einzelne Schlagworte wurden überstrapaziert. Doch vielleicht lang genau in der Zuspitzung, der Zwang nach eigener Positionierung.
Theater als Forschungslabor
Das Institut für Medien, Politik und Theater, mit Felix Hafner, Emily Richards, Jennifer Gisela Weiss und Anna Wielander, hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Akteur zwischen Journalismus und Theater entwickelt. Ihr Ansatz ist es gesellschaftspolitische Phänomene nicht nur künstlerisch zu verarbeiten, sondern journalistisch zu recherchieren und dann in eine theatrale Form zu übersetzten.
Vor jeder Produktion steht eine intensive Recherchephase darunter die Lektüre wissenschaftlicher Texte, Gespräche mit Expert*innen oder journalistisches Material. Auf dieser Basis entstehen erste fiktionale Outlines, die mit dem Ensemble improvisiert und weiterentwickelt werden. Das Resultat ist ein Theater, das gleichermaßen präzise wie flexibel bleibt, dabei können politische Ereignisse und gesellschaftliche Debatten jederzeit in die Stücke eingeschrieben werden.
Dieser Zugriff macht die Arbeiten des Instituts zu etwas Eigenem, das Recherchetheater. Während Journalismus oft an bunten Darstellungsgrenzen scheitert, schafft das Theater einen Ort, an dem Widersprüche unterhaltsam sichtbar werden.
Coping auf der Bühne
Warum macht Recherche Sinn im Theater? Weil es die vielleicht zeitgemäßeste Antwort auf die Gegenwart ist. Während der klassische Dramenkanon oft weit entfernt von akuten politischen Entwicklungen bleibt und uns eher als Ablenkung dient, unterstreicht das Institut unsere Bedenken.
Recherchetheater ist laut dem Institut kein fertiges Produkt, das eine Wahrheit ausstellt, sondern ein Prozess, Regie, Dramaturgie und Schauspiel arbeiten gleichberechtigt, Texte entstehen kollektiv, Positionen (und Schauspieler*innen) reiben sich aneinander. Für das Publikum bedeutet das nicht einfache Antworten.
Bettina Frenzel ©
In Retrotopia kommt diese Methode besonders fesch zum Vorschein. Die grotesken Szenen um Küchendienst und „Norma“-Mantras wirken umso verstörender, weil sie sich so nah an realpolitische Diskurse anlehnen. Das Theater reagiert mit Tradewife-Content auf politische Tendenzen, die bereits Teil unseres Alltags sind. Das Institut versteht Retrotopia nicht nur als Stück, sondern als Coping-Strategie. Also eine künstlerische Möglichkeit, mit dem globalen Rechtsruck, mit antifeministischen Backlashs und gesellschaftlicher Regression umzugehen.
Mit früheren Arbeiten wie Nestbeschmutzung (Nestroy-Preis 2024) hat das Institut für Medien, Politik und Theater bereits gezeigt, dass es Themen mit Auszeichnung behandeln kann. Dass die Bühne dabei zur politischen Reflexion wird, ist kein Nebeneffekt, sondern eben genau Kern des Konzepts.