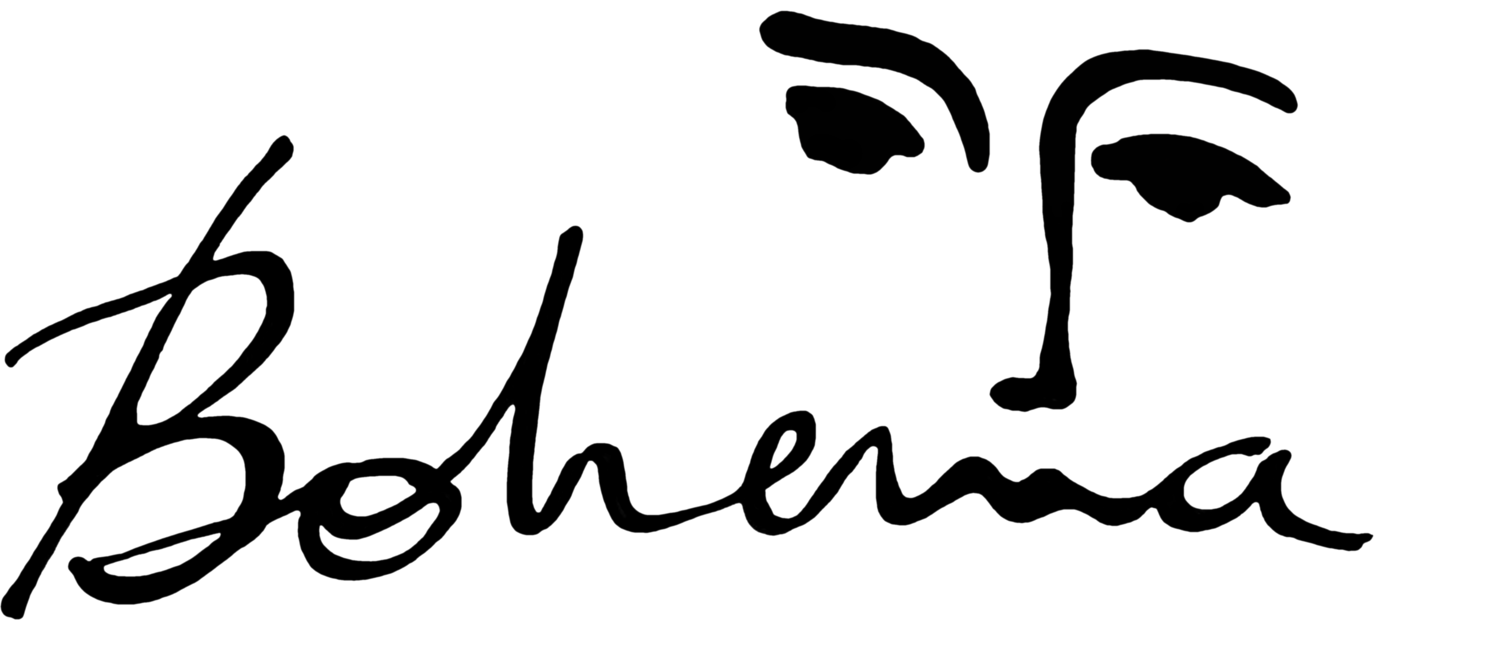Machen Nazis die Badezimmertür zu?
Warum wir uns kollektive Lügen erzählen. Von Mayenbergs Figuren in der schwarzen Komödie Nachtland in den Kammerspielen der Josefstadt ziehen es vor. Denn Ehrlichkeit würde Moral bedeuten.
Silvia Meistere und Roman Schmelzer /// Christian Wind ©
Ein L von einem T zu unterscheiden, ist nicht nur auf dem Rezept nach dem Arztbesuch schwierig. Meistens kommt man sich vor wie eine unterbezahlte Archäologin beim Entziffern von Hieroglyphen. Manchmal möchte man aber vielleicht doch gar nicht so genau wissen, was dort tatsächlich steht – wenn man nämlich erfährt, dass der eigene Vater nach 1933 doch mehr von der braunen Suppe gelöffelt hat, als zuvor gedacht.
Staub, Kisten und braune Vergangenheit
In der Komödie Nachtland von Marius von Mayenburg, inszeniert an den Kammerspielen in der Josefstadt, stellen sich genau diese Frage die beiden Geschwister Nicola und Phillip, als sie das Haus des Vaters entrümpeln. Dabei graben sie sich nicht nur durch Staub, Kisten und kaputte Möbel, sondern auch durch die undurchsichtige Vergangenheit des frisch verstorbenen Vaters. Die beiden stellen dabei nicht nur das alte Haus auf den Kopf, sondern auch das Bild, das sie bisher von ihrem Vater hatten.
In einem schlichten Bühnenbild – bestehend aus ein paar Wänden mit Flur und zwei Türen, eine zum Badezimmer und eine zu einem nicht einsehbaren Raum – treffen die Geschwister nach dem Tod des Vaters erstmalig wieder aufeinander. Bei der Entrümpelung gemeinsam mit ihren jeweiligen Ehepartner*innen stößt Phillips Frau Judith auf ein altes Gemälde. Unscheinbar, dunkel und fast langweilig erscheint es allen auf den ersten Blick. Die Schwester will es sogar zusammen mit dem restlichen Müll und Erinnerungen wegwerfen. Doch eine kleine rote Unterschrift in der Ecke bringt das Räumungsquartett zum Stocken: „A. Hiller“ – oder doch „A. Hitler“?
Auf einmal hat jede*r auf der Bühne eine Meinung zu dem bemalten und gerahmten Stück Papier. In schnellen Dialogen und einem scharfzüngigen Schlagabtausch kreisen bald alle Gemüter nur noch um die Frage: „Was machen wir mit diesem Bild?“ Während Phillip sein plötzliches Interesse mit der „meisterhaften Malerei“ begründet, sieht seine Schwester bereits die Verkaufssumme vor Augen – und Phillips Frau ihre Ehe vor dem Abgrund. Plötzlich entsteht ein „Du“ und „Wir“, ein „Ihr“ – und ein „Wir zusammen, nur mit Trotz“. Judith ist Jüdin, was den Handlungsverlauf entscheidend beeinflusst.
„Ich hab nichts gemacht“
Die Handlung nimmt durch neue Figuren weitere Wendungen. Eine Kunstexpertin identifiziert das Bild als „Originalen Hitler“, was sie in einen Sturm der Begeisterung versetzt – etwas zu euphorisch, um nur die angeblichen Pinselstriche zu meinen. Ein potentieller Käufer hingegen besteht auf Anonymität – „Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht, Schall und Rauch!“ – und möchte das Gemälde selbstverständlich nur wegen seines künstlerischen Werts erwerben. Doch würde er wirklich 10.000 Euro für ein namenloses Kunstobjekt zahlen? Welchen Wert hat das Bild für jede*n der fünf, wenn dieses fragwürdige T doch nur ein L wäre? Wenn eben nicht Hitlers Hand mit etwas zu viel Selbstvertrauen die Dorfszene gepinselt hätte?
In einem zynischen Monolog hinterfragt der dubiose Käufer, wie ein Alltag, ein soziales Miteinander – Kultur – überhaupt möglich sein soll, wenn wir uns immer nach den Schaffenden richten müssen. Also: alle Mittel zum Zweck? Lieber kollektiv belügen oder sich an den Gedanken klammern: „Ich habe nichts gemacht“? Er nennt Goethe, einen Antisemiten, Voltaire, einen „Judenhasser“, Picasso und zahlreiche expressionistische Maler – Missbrauchstäter. Trotzdem fühlen wir uns kulturaffin, wenn wir ihre Werke bestaunen. Das Publikum, zuvor noch geschockt von der fehlenden Moral und der Gier der Protagonist*innen, blickt nun peinlich berührt um sich.
Die Tür
Die Badezimmertür bleibt als einziger Teil des Bühnenbilds dynamisch. Sie lässt das Publikum durch eine Spiegeltür ins Innere blicken – nur dann, wenn sie geöffnet wird. Immer dann, wenn im Streit Judith auf der einen und der Rest auf der anderen Seite steht. Der Spiegel gibt den Blick frei auf den grauen Duschvorhang und den etwas zu breiten Duschkopf. Bilder von Duschen in Gaskammern des Holocaust schießen einem durch den Kopf. Doch genauso schnell ist die Tür wieder zugeschlagen – bis sie Phillips Moral zum Verhängnis wird.
Mayenburg bringt mit dem Ensemble der Kammerspiele das Publikum zum Lachen, kratzt dabei an moralischen Grenzen – bis er ihnen den Spiegel vorhält und so mancher Lacher im Hals stecken bleibt. Er fragt, was wirklich hinter Kultiviertheit steckt. Denn: Schall und Rauch lösen sich auf.