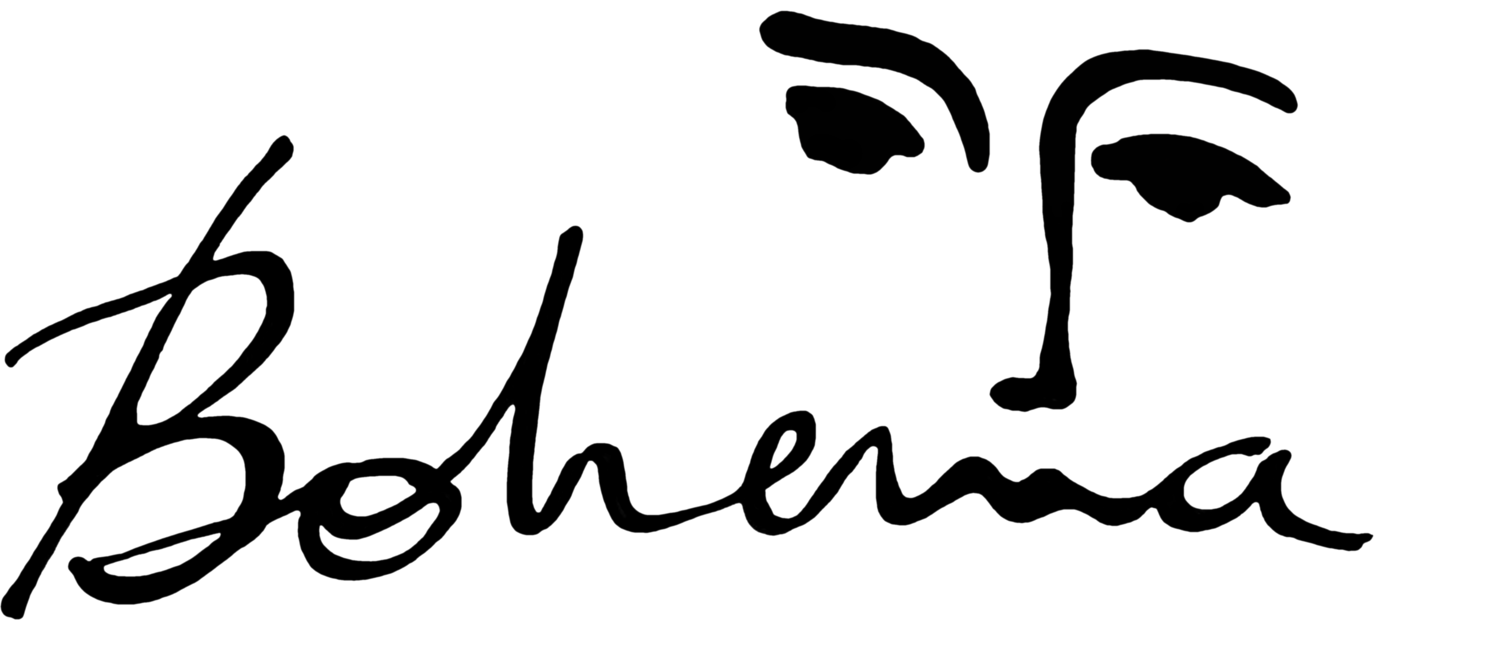Bunker der Selbstgenügsamkeit
Gewalt-Systeme auf der Opernbühne – Die Salzburger Festspiele versuchen sich am politischen Musiktheater und machen sich die Analyse etwas zu einfach. Ein Bericht.
Willkommen im Bunker /// SF, Monika Rittershaus ©
Eine Leiche wird durch den Bunker des Machthabers Giulio Cesare gezogen. Drei Schwestern schwindet auf den Ruinen des Krieges die Hoffnung; die Soldaten sagen ihnen nicht „auf Wiedersehen“, sondern „Lebewohl“. Eine Frau muss davon ausgehen, dass ihr Geliebter zu Tode gefoltert wurde. Königin Elisabeth wird von ihrem Machtapparat dazu getrieben, ihre Widersacherin Maria Stuarda hinrichten zu lassen.
Ganz schön düster …
… geht es dieses Jahr in den Opern der Salzburger Festspiele zu. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser möchte beweisen, dass er die Augen vor dem Leid der Welt nicht verschließt und der politischen Verantwortung der öffentlich geförderten Festspiele nachkommt. Genügen Gewalt und Elend auf der Opernbühne für ein politisches Musiktheater oder braucht es für eine produktive, kritische Auseinandersetzung mehr? Fünf Produktionen im Blick:
Giulio Cesare in Egitto
Dmitri Tcherniakov ist als „psychologischer Tiefenbohrer“ unter den Opernregisseuren bekannt. Seine selbst entworfenen Bühnenbilder sind von nahezu filmischem Realismus. Als Schauplatz für Händels Giulio Cesare in Egitto hat er einen Betonbunker auf die Bühne bauen lassen. Laute Detonationen und Sirenengeheul machen spürbar, dass draußen Krieg herrscht. Als der Leichnam des Politikers Pompeius durch den Bunker gezogen wird, entspinnt sich das politische wie persönliche Drama. Pompeius’ Frau Cornelia und ihr gemeinsamer Sohn Sesto sind verzweifelt, schreien und zittern. Sopranist Federico Fiorio singt Sesto mit zarter, jugendlich unschuldiger Stimme. Im Gegensatz zu seinem Gesang erscheint sein Schauspiel, wenn er zitternd die Gewalt-Traumata verkörpern soll, überzeichnet.
Düster düster /// SF, Monika Rittershaus ©
Dass das Spiel der Sänger*innen fast durchweg hölzern wirkt, entwickelt sich zum wesentlichen Problem des Abends. Tcherniakov behandelt die Opernbühne als wäre sie eine Kinoleinwand. Opernsänger*innen können aber nicht so nuancierte psychologische Regungen spielen wie Schauspieler*innen aus Hollywood. Daher verkommen die Figuren oft zu eindimensionalen Stereotypen. Das beste Beispiel hierfür ist der von Yuriy Mynenko verkörperte Bösewicht Tolomeo. Tcherniakov versieht ihn mit einer blonden Schmalzlocke, die er sich ständig aus dem Gesicht wischen muss, sodass alle begreifen: „Vorsicht, eingebildeter Macho!“ Von einer nuancierten Rollenarbeit, wie man sie vom Großmeister des psychologischen Theaters erwarten würde, ist wenig zu erkennen.
Als festspielwürdig behauptet sich die Produktion durch ihre musikalische Qualität. Das Barockorchester Le Concert d’Astrée lässt unter der Leitung von Emmanuelle Haïm die Facetten in Händels Partitur schillern und trägt so zum Porträt der verletzlichen Held*innen bei. Countertenor Christophe Dumaaux als Machthaber Giulio Cesare und Olga Kulchynska als Cleopatra sind die Stars des vokalstarken Ensembles und begeistern das Publikum mit kristallklaren Koloraturen.
One Morning Turns into an Eternity
Die Musik von drei Komponisten der Wiener Moderne erklingt in One Morning Turns into an Eternity. Arnold Schönbergs Monodram Erwartung und der letzte Satz aus Gustav Mahlers sinfonischem Liederzyklus Das Lied von der Erde thematisieren den Abschied von einem geliebten Menschen. Zwischen diesen beiden halbstündigen Kompositionen, in denen jeweils eine Sängerin auftritt, sind Anton Weberns Fünf Stücke für Orchester positioniert. So entsteht ein außergewöhnlicher, nur knapp über eine Stunde dauernder Musiktheaterabend.
Auch zu Beginn von One Morning Turns into an Eternity wird eine Leiche auf die Bühne getragen. Eine Frau kniet sich vor den Leichensack, traut sich nicht, ihn zu öffnen und versucht zu begreifen, dass ihr Geliebter zu Tode gefoltert wurde. Sie durchlebt die vergangene Beziehung. Sopranistin Aušrinė Stundytė steigert sich anhand Schönbergs Musik in die Angst, Ratlosigkeit, Hoffnung und Trauer der Frau hinein und verleiht den Gefühlen mit ihrer mal dunkel dröhnenden und im nächsten Moment klaren und scharfen Stimme Ausdruck. Stundytė läuft unruhig über die Bühne, erstarrt, versenkt sich im imaginierten Zwiegespräch mit dem Leichnam. Das ist sängerisch wie darstellerisch herausragend!
Aušrinė Stundytė /// SF, Ruth Walz ©
Nach Weberns Orchesterstücken steht Altistin Fleur Barron allein auf der großen Bühne und singt mit warmer Stimme von der Suche nach Ruhe für ein einsames Herz. Mahler vertonte Gedichte von Meng Haoran und Wang Wei, in denen kaum noch eine Handlung zu erkennen ist. Stattdessen wird den Gefühlen Raum gegeben. Lichtdesigner James F. Ingalls richtet die Scheinwerfer auf den verspiegelten Bühnenboden, sodass sich das Licht kunstvoll an den steinernen Wänden der Felsenreitschule bricht. Anstatt wie in Giulio Cesare die Realität zu imitieren, schafft das abstrakte, dunkle Bühnenbild von George Tsypin eine gefühlvolle Atmosphäre. Der schlichte Bühnenraum lenkt die Aufmerksamkeit auf die beiden beeindruckenden, einsam agierenden Gesangsdarstellerinnen. Regisseur Peter Sellars, früher für gesellschaftskritische Inszenierungen bekannt, gibt dem Publikum dieses Mal mehr Gefühle als Gedanken mit.
Maria Stuarda
Riesige Drehscheiben und Laufbänder sind das Markenzeichen des Schauspiel-Regisseurs Ulrich Rasche. In Salzburg präsentiert er mit Gaetano Donizettis Maria Stuarda seine erst dritte Produktion für die Opernbühne. Hierfür ließ Rasche (der wie Tcherniakov sein eigener Bühnenbildner ist) gleich zwei Drehscheiben in den finsteren Bühnenraum des Großen Festspielhauses bauen. Eine Drehscheibe für Maria Stuarda, Königin von Schottland. Die andere für Elisabeth I., Königin von England. Da die Katholik*innen Maria Stuarda an Stelle von Elisabeth als rechtmäßige Erbin des englischen Throns ansehen, entzündet sich ein politischer Konflikt. Elisabeth ringt damit, Maria Stuarda hinrichten zu lassen, um ihre eigene Macht zu sichern.
Drehbühne der Politik /// SF, Monika Rittershaus ©
Auf den beiden ständig rotierenden Drehscheiben stehen neben den Sänger*innen 18 junge männliche Tänzer. Wobei „stehen“ falsch ist, denn die Darsteller*innen machen wirklich alles, außer zu stehen: sie marschieren, schreiten, kriechen, kämpfen sich voran, versuchen, auf der Bühne der Politik Haltung zu bewahren. Die Tänzer drängen die Sänger*innen in Positionen. So wird bildlich, dass Macht und Gewalt nicht nur von persönlichen Einzelinteressen abhängen, sondern durch komplexe politische Zusammenhänge geformt werden. Die Figuren sind Getriebene. Rasche interessiert sich nicht für die historische Realität, sondern für die Prinzipien der Macht, die er in unterschiedlichen Gangarten ästhetisiert.
Gaetano Donizettis Musik gilt als Paradebeispiel des Belcanto, des „schönen Gesangs“. Die Sänger*innen können in kunstvollen Koloraturen die Schönheit ihrer Stimme präsentieren. Lisette Oropesa scheint als Maria Stuarda, im langen weißen Kleid, die Figuration des Belcanto zu sein. Ihre Stimme glänzt und meistert alle Höhen mit Leichtigkeit. Kate Lindsey, im langen schwarzen Kleid, gestaltet die intrigante Elisabeth auch stimmlich dunkler und mit viel Ausdruck für die Zerrissenheit zwischen Willen zur Macht und Empathie. Maria Stuarda besticht schlussendlich mit zwei herausragenden Sängerinnen und gewaltigen Bildern.
Drei Schwestern
Die zuvor besprochenen Inszenierungen setzen sich mit Gewaltregimen auseinander, ohne Kriegsgebiete zu zeigen. Das ist in Drei Schwestern anders. Die Ruinen einer zerbombten Eisenbahnbrücke wurden auf die Bühne der Felsenreitschule gebaut. Der letztes Jahr verstorbene Komponist Peter Eötvös folgt in seiner düsteren Opern-Version von Drei Schwesternnicht der chronologischen Reihenfolge aus Tschechows gleichnamiger Dramenvorlage. Stattdessen wird die Geschichte dreimal aus Sicht unterschiedlicher Figuren erzählt. In den Trümmern verschwimmen leidvolle Erinnerungen und Realität. Der neu zusammengesetzten Handlung ist schwer zu folgen, stattdessen wird ein melancholisches Gefühl vermittelt.
Da das Publikum noch weniger als im tschechowschen Original über den konkreten Ursprung der Trostlosigkeit erfährt, verweist die Oper laut Regisseur Evgeny Titov auf „etwas Allgemeineres, Überindividuelles“. Die mit Bühnenbildner Rufus Didwiszus getroffene Entscheidung, Kriegsruinen auf die Bühne bauen zu lassen, begründet Titov im Programmheft wie folgt: „Es geht in Drei Schwestern um das Leben, wie es ist, und ich will eine Realität zeigen, die wir vielleicht nicht sehen wollen, in der wir aber leben. Durch das von Zerstörung geprägte Setting wird alles, was darin geschieht, in seiner existenziellen Dringlichkeit noch gesteigert.“ Einerseits ist es wichtig, dass Titov die brutale Realität aufzeigen und Mitleid vermitteln will. Andererseits stehen die doch recht plakativen Trümmer im Widerspruch zur von Titov selbst vorgeschlagenen Lesart universellen Leidens.
Ästhetische Kriegsruinen /// SF, Monika Rittershaus ©
Das mondäne Festspiel-Publikum betrachtet willig die trostlosen Szenen im – wieder ein Zitat Titovs – „provinziellen, rohen und uninspirierenden Umfeld“. Am Ende der Vorstellung applaudiert das Publikum brav, aber verhalten. Alle sind sich einig, dass man die Augen vor dem Leid der Welt nicht verschließen darf und man einen innerhalb der Mitleidsökonomie relevanten Abend gesehen hat. Aber anstatt einer kritischen Auseinandersetzung vollzieht Titov in den illustrativen Trümmern eine Stereotypisierung des Leidens. So kratzt diese Drei Schwestern-Produktion gefährlich an der Kategorie „Kunst als Ablasshandel“. Das Publikum darf beruhigt sein, denn es hat ein politisch relevantes Stück gesehen, ohne die eigene Position und das zukünftige Handeln in Frage stellen zu müssen.
Hotel Metamorphosis
Kurz bevor man endgültig in der Salzburger Finsternis versinkt, erscheint Regisseur Barrie Kosky mit einer Schar aufgedrehter Tänzer*innen, glitzernden Kostümen und einem Potpourri ungeahnter Vivaldi-Melodien wie das Licht am Ende des Festspieltunnels. In einem Hotelzimmer, wie es jede Festspielbesucher*in kennt, sitzt die 81-jährige Schauspielerin Angela Winkler als Orpheus und erzählt mit sanfter Stimme die jahrtausendealten Geschichten aus Ovids Metamorphosen. Immer neue Hotelgäste beziehen das anonymisierende Zimmer, lieben und leiden in ihm. Sie sind heutige Versionen der ovidischen Figuren und singen Arien und Ensembles aus den Opern Antonio Vivaldis. Hotel Metamorphosis ist keine klassische Oper, sondern ein Pasticcio, das entstand, indem bestehende Musik und Texte neu zusammengefügt wurden.
Der erste Hotelbesucher ist der von Countertenor Philippe Jaroussky verkörperte Pygmalion. In der mythischen Vorlage erschafft der Bildhauer Pygmalion eine Skulptur, die er so sehr bewundert, dass er sie für menschlich hält und sich in sie verliebt. Jarousskys Pygmalion trägt karierten Pullunder und hat eine Schaufensterpuppe dabei, die er anhimmelt und sexualisiert. Die Begegnung von Ovids Erzählung mit einer heutigen Szenerie beleuchtet über Jahrtausende hinweg überzeichnete Schönheitsvorstellungen und unerwiderte Liebesgefühle. Indem Pygmalions Liebe ernst genommen wird und Jaroussky sich spielfreudig fürsorglich um die Puppe kümmert, gelingt es, Pygmalion als gleichermaßen beängstigenden wie liebenswerten Außenseiter zu porträtieren. Mit ambivalenten Figuren wie dieser kann das Theater gegen simplifizierende Kategorien kämpfen, in die die Welt zu pressen versucht wird.
SF, Monika Rittershaus ©
Gianluca Capuano dirigiert die Musiciens du Prince und lässt Vivaldis Musik mal zart, mal freudig beschwipst, dann wieder hart und feurig daherkommen. Dass auch durchaus unbekannte Melodien erklingen, dürfte Entdeckungen für Barockliebhaber*innen bereithalten. Die Gesangsdarsteller*innen, die alle mehrere Rollen übernehmen, vervollkommnen den Abend. Sopranistin Lea Desandre gluckst vergnügt als Echo und singt sanfte Wehklagen, wenn sie als unglücklich in ihren eigenen Vater verliebte Myrrha in einen Baum verwandelt wird. Cecilia Bartoli beweist nicht nur in den Trauerarien Euridices ihren Status als Opernstar, sondern besticht auch im divenhaften Duell der Webkünstlerinnen zusammen mit Mezzosopranistin Nadezhda Karyazina mit komödiantischen Timing. Das Publikum quittiert den schillernden Abend mit Szenenapplaus und Standing Ovations.
Politisch, aber nicht kritisch
Journalistin Hedwig Kainberger bewertet in den Salzburger Nachrichten die Festspiel-Produktionen als „Zumutungen im besten Sinne, weil sie dazu anregen, brisante Nöte zu bedenken und mitfühlend aufzuspüren“. Indem sich die Salzburger Festspiele der Antikriegspolitik und Antiautokratiepolitik verschreiben, verteidigen sie laut Kainberger Demokratie und Zivilcourage und werden ihrem „hohen politischen Anspruch“ gerecht. Das stimmt, aber vielleicht ist der Anspruch nicht hoch genug gesetzt, genauer gesagt, nicht kritisch genug. Die Produktionen scheitern allesamt daran, nach der Verantwortlichkeit der Festspiele und ihres Publikums zu fragen. Das ist um so bedauernswerter, wenn man weiß, dass Peter Sellars und Evgeny Titov in früheren Produktionen durchaus Selbstkritik gelang: Letztes Jahr porträtierte Sellars bei den Salzburger Festspielen in Der Spieler eine risikofreudige und verantwortungslose Vergnügungsgesellschaft, anhand derer er dem Salzburger Publikum den Spiegel vorhielt. Titov kritisierte und zelebrierte in seiner Inszenierung von Iolantaan der Wiener Staatsoper die Oper als Institution, die durch fantastische Scheinwelten eine naive Flucht vor der Realität ermöglicht.
Die Frage nach der eigenen Verantwortlichkeit angesichts der Gewalt traut sich keine der diesjährigen Festspiel-Produktionen explizit zu stellen. Damit bleiben sie hinter den Möglichkeiten dessen zurück, was Musiktheater kann. Wenn die Salzburger Festspiele ihre eigene Verflechtung in den Krisen der Gegenwart nicht in den Blick nehmen, werden sie den aufgezeigten Problemen nicht gerecht. Nebenbei bemerkt: sich künstlerisch mit Gewalt-Systemen auseinandersetzen zu wollen und alle Musiktheaterproduktionen unbefragt in die Hand männlicher Regisseure zu legen, ist schon auf den ersten Blick keine ideale Setzung. Neben den fünf besprochenen Produktionen stand noch die Wiederaufnahmen von Giuseppe Verdis Oper Macbeth über ein aus Machtgier mordendes Herrscherpaar in der Regie von Krzysztof Warlikowski auf dem Spielplan.
Nur Hotel Metamorphosis fällt aus der düsteren Festspiel-Programmatik heraus. Das hat Gründe: Die Produktion feierte bereits im Rahmen der Pfingstfestspiele Premiere. Anders als die Sommerfestspiele werden diese nicht von Markus Hinterhäuser, sondern von Cecilia Bartoli geleitet. Das Highlight der Festspiele entstammt gerade nicht Hinterhäusers trübsinniger Programmatik. Anstatt sich Finsternis, Gewalt und Mitleid zu verschreiben, zeigt Hotel Metamorphosis die schillernde Vielschichtigkeit des Theaters und der Welt auf. Indem simplifizierenden Kategorien und Stereotypen eine Absage erteilt wird, erfüllt der Vivaldi-Abend eine nicht weniger politische Funktion als die übrigen Produktionen, die sich um Gewaltanalysen und Mitleidsvermittlung bemühen.