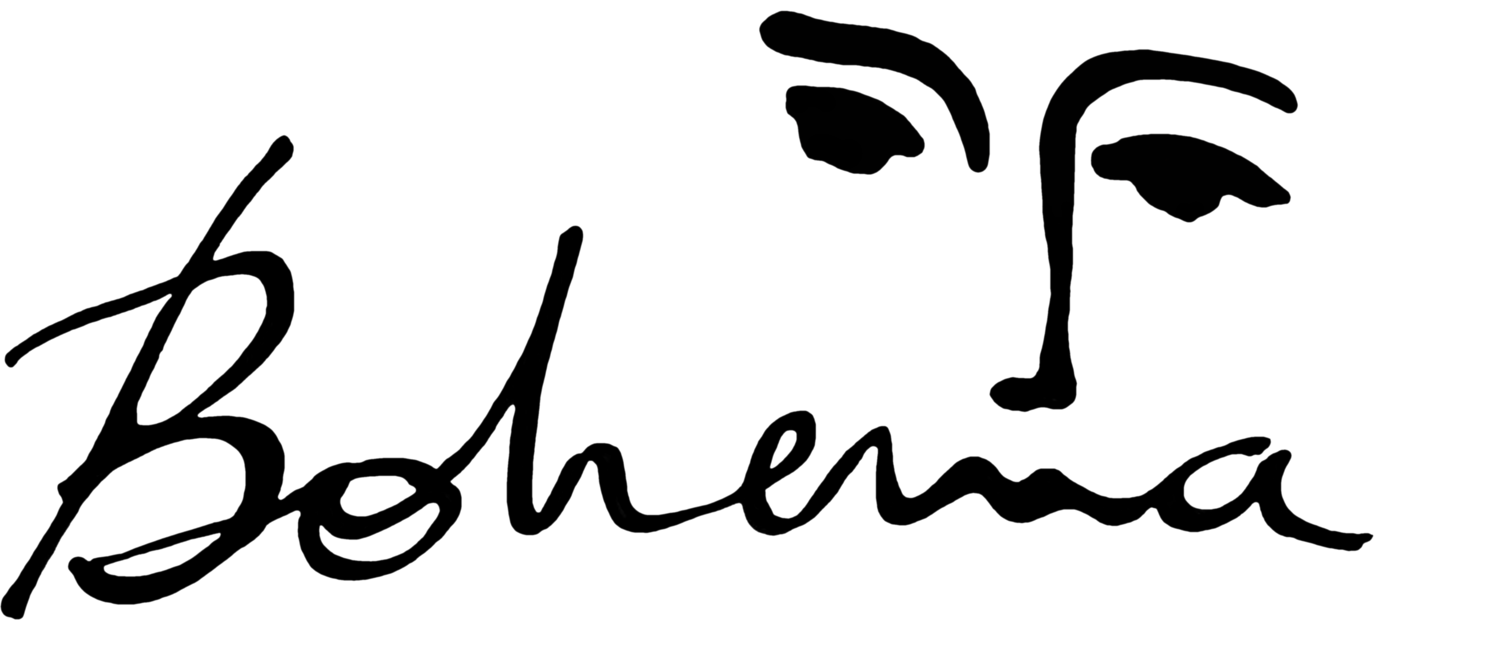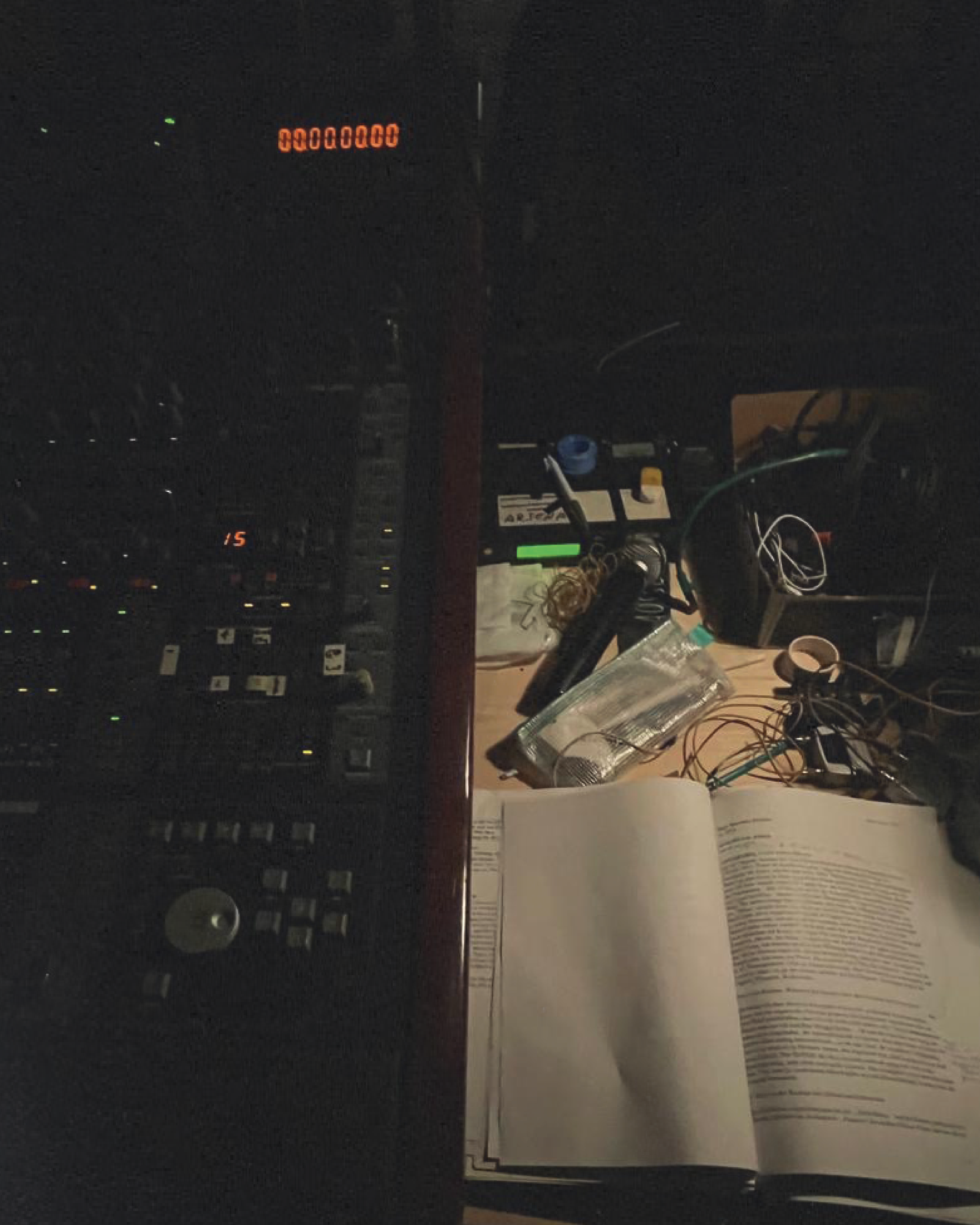Ein Ort namens Burgtheata
Elfriede Jelineks seit über 40 Jahren gesperrtes Stück Burgtheater Posse mit Gesang kam endlich in die Burg: Was Milo Rau aus dem Stück machte. Kontext und Blick hinter die Kulissen einer historischen Produktion.
Minichmayr in der Burg /// Tommy Hetzel (©)
Transparenzhinweis: Die Autorin war Regiehospitantin bei der Produktion.
damals
Als Elfriede Jelinek ihr Stück in der Zeitschrift Mosaik veröffentlichte, traf sie auf eine Öffentlichkeit, die bereitwillig zur Abwehr griff. Rasch war von „Nestbeschmutzung“ die Rede – ein Begriff, der in Österreich immer dann aufgerufen wird, wenn kulturelle Selbstbilder ins Wanken geraten. Exemplarisch untersuchte Jelinek eine etablierte Schauspieler*innendynastie im Kontext der Institution Burgtheater im historischen Licht. Ihr Vorwurf: opportunistische Anpassung, vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus.
Die Namen Paula Wessely und Attila Hörbiger erscheinen im Stück nicht ausdrücklich, doch Jelinek ließ keinen Zweifel an den realen Vorbildern. Damit verweigerte sie genau jenes Schweigen, das die Nachkriegszeit lange geprägt hatte – das stille Übereinkommen, die Verstrickungen prominenter Kulturschaffender nicht weiter zu thematisieren. Indem sie die Beteiligung der Burgtheater-Ikonen an nationalsozialistischen Propagandafilmen offenlegte, entzog sie ihnen den Nimbus des Unantastbaren. Aus gefeierten Kulturträgern wurden Komplizen einer totalitären Kulturindustrie.
Die moralische Unschuld Österreichs? Pff
Damit stellte Jelinek nicht nur einzelne Karrieren infrage, sondern das Fundament einer kollektiven Selbstinszenierung. Österreichs Rolle als „Kulturnation“ beruhte über Jahrzehnte auf einem Bild der moralischen Unschuld, das die eigene Verstrickung in das NS-System ausblendete. Jelineks Stück zerstörte diese Illusion – und löste genau deshalb so heftige Abwehrreaktionen aus.
Im Hinblick auf das Burgtheater eröffnet Jelineks Stück eine doppelte Traditionslinie. Einerseits verkörpert die Bühne selbst jene institutionalisierte Kontinuität, die sich gern als „Nationaltheater“ versteht. Andererseits spiegelt die von ihr angeführte Schauspielerfamilie diese Logik auf privater Ebene: eine genealogische Weitergabe des Handwerks, die von Generation zu Generation als Erfolgsgeschichte erzählt wird. Familie wie Institution berufen sich auf eine Vergangenheit, die als kulturelles Kapital fungiert. Die Besetzung von Mavie Hörbiger als Enkelin von Paul Hörbiger, der zu jenem Clan gehörte und den sie im Stück selbst verkörpert, scheint in diesem Zusammenhang besonders interessant.
Tommy Hetzel ©
Genau dort setzt Jelineks Intervention an: Sie attackiert jene Tradition, die nicht aus Reflexion, sondern aus ungebrochener Übernahme lebt – und enthüllt die Schattenseiten eines kulturellen Selbstverständnisses, das sich nur allzu bereitwillig über historische Verstrickungen hinwegsetzt. Der Skandal war somit mehr als ein Streit um eine literarische Provokation. Er war ein Symptom jener österreichischen Erinnerungskultur, die lange Zeit von Verdrängung und Verklärung geprägt war. In dieser Hinsicht erwies sich Jelineks Arbeit als seismografisch: Sie machte sichtbar, was man nicht sehen wollte, und entlarvte das Theater selbst als Bühne nationaler Mythenproduktion.
„Burgtheater ist in Österreich wie eine Wunde,
die immer noch offen ist und immer noch weh tut.“
— Pia Janke im Gespräch mit Elfriede Jelinek:
Hinter dem Lachen stecken die Brutalität und die Grausamkeit.
Dass Elfriede Jelinek ihr Stück Burgtheater selbst als ein genuin „österreichisches“ Werk verstand, liegt nicht zuletzt in seiner Sprache begründet: einer dialektal gefärbten Kunstsprache, die sich kaum übersetzen und schon gar nicht auf fremden Bühnen transplantieren lässt. Umso paradoxer scheint es, dass die Uraufführung 1985 in Bonn stattfand – in einem Umfeld also, dem zentrale Anspielungen und Assoziationsketten notwendigerweise entglitten. Leerstellen im Verständnis waren programmiert, sowohl durch die sprachliche Dimension als auch durch die spezifisch österreichischen Referenzen.
Eine zweite Inszenierung folgte 2005 in Graz, dann Funkstille. Nach dem massiven Gegenwind der damaligen Zeit entzog sie dem Theater die Möglichkeit der Wiederaufführung und sperrte Burgtheater für alle Bühnen. Im Rückblick wirkt es wie ein Werk, das „zu früh“ kam: Der kulturpolitische Resonanzraum der 1980er-Jahre war kaum bereit für die Provokation, die Jelinek ihm zumutete. Nun ist es dort angelangt, wo es hingehört, auf „die Bretter, die die Welt bedeuten.“ (Aus Jelineks Burgtheater)
heute
© Merle Proll
Dieses Projekt ist in jeglicher Hinsicht intensiv. Der Inhalt liegt schwer im Magen und der Druck lastet auf den Schultern. In die öffentliche Wahrnehmung kehrt es als „Skandalstück“ zurück. Der Begriff ist zur Chiffre geworden, eine Art Vermarktungssiegel, das über die eigentliche Textsubstanz gelegt wird. Man könnte sagen: Burgtheater ist Jelineks Faust von Goethe – vielleicht weniger kanonisch verankert, aber im literarischen Wellenschlag ebenso tiefgreifend, ein entscheidender Markstein im Werk der Autorin.
Schon kurz nach Erscheinen heftete man Jelinek ein Stigma an, das vielfach lauter war als die genaue Auseinandersetzung mit dem Text selbst. Für die Autorin blieb Burgtheater daher nicht nur ein Werk der literarischen Provokation, sondern auch ein Trauma. Die Angst, alte Wunden aufzureißen und sich erneut in ein endloses Rechtfertigen gedrängt zu sehen, liegt auf der Hand. Trotzdem hat Jelinek ihr Stück, das begraben schien, Milo Rau anvertraut. Die Frage stellt sich mit Nachdruck: Wie lässt sich ein derart dichter, politisch aufgeladener Text in kurzer Zeit auf die Bühne bringen, ohne ihn zu verflachen, ohne ihn in den Mechanismen heutiger Theatereffekte zu verlieren? Raus Zugriff auf das Material wird zur Nagelprobe – nicht nur für die Deutbarkeit Jelineks, sondern auch für den gegenwärtigen Theaterbetrieb selbst.
Tommy Hetzel ©
Gerade hier öffnet sich ein kulturpolitischer Resonanzraum: In einer Zeit, in der Debatten über Erinnerungskultur, historische Verantwortung und den Umgang mit „Cancel Culture“ hochaktuell sind, erhält Jelineks Stück neue Brisanz. Es stellt nicht nur die Frage nach der Rolle des Theaters als moralisches Forum, sondern auch nach dem Umgang einer Gesellschaft mit ihrer eigenen Geschichte.
Milo Rau wäre nicht Milo Rau…
…wenn er nicht mit einem dokumentarischen Ansatz an das Stück herantreten würde. Schicht für Schicht hat das Team abgekratzt - Abgründe haben sich aufgetan - folgend wurde sortiert und neu zusammengesetzt. Das Ergebnis ist keine klassische Inszenierung im engeren Sinn, sondern eine Collage, die weit über die Grenzen des titelgebenden Stücks hinausreicht. Wer behauptet, es sei „zu wenig Jelinek“ geblieben, verkennt die Logik dieses Zugriffs. Raus Verfahren integriert Texte aus anderen Schaffensphasen der Autorin – etwa Der Atem-Automat oder Die Erlkönigin – ebenso wie persönliche Bezüge der Darstellenden, Burgtheater Anekdoten und Materialien aus Filmen wie beispielsweise Heimkehr, auf den Jelinek sich im Stück bezieht. So entsteht ein Gewebe, in dem sich Dokument und Fiktion, Text und Biografie, Geschichte und Gegenwart unauflöslich verschränken. Die Frage ist daher weniger, ob Jelinek „genug“ präsent ist, sondern in welcher Form sie sich zeigt – und ob das Publikum in der Lage ist, diese Spuren zu lesen. Wer Jelinek sucht, wird sie finden. Doch das Wiedererkennen verlangt, den vertrauten Blick aufzugeben und sich auf ein Verfahren einzulassen, das Jelineks Sprachwelten nicht reproduziert, sondern in neue Kontexte einschreibt.
„So komme ich mir vor. Ich sitze seit so vielen Jahren unter dem Tisch, spiele aber immer dieselbe Partie, weil ich sie spielen muß, ich spiele sozusagen unter der Drohung, daß etwas Entsetzliches passieren könnte, wenn ich aufhöre. Damit überschätze ich mich natürlich total. Aber jetzt tritt diese Puppe aus dem Dunkel einer Tischdecke hervor und spricht als sie selbst. Als ich. Ja, Sprechpuppe, das werden sie abfällig sagen.“
Aus Der Atem-Automat 2024,
Jelinek Website
Wie schon Jelineks Original ist auch Milo Raus Version von Burgtheater eine Überforderung im positiven Sinne: eine Flut an Eindrücken, die keinen Anspruch darauf erhebt, vollständig erfasst zu werden. Auf der Drehbühne reiht sich Slapstick an Akrobatik, parallel laufen Live-Kamerabilder über die Leinwand – Augen und Ohren werden unablässig gefordert.
Damit diese orchestrierte Reizüberflutung funktioniert, vertraut Rau einmal mehr auf sein eingespieltes Team. Anton Lukas ist für die präzise durchkomponierte Bühne verantwortlich, Moritz von Dungern für die Videobearbeitung, und Elia Rediger, bekannt auch aus dem „Caravan of Luv“ bei den Wiener Festwochen, liefert den musikalischen Untergrund. Es sind allesamt eigenständige künstlerische Stimmen, deren Beiträge sich nicht vollständig erfassen lassen – und gerade darin liegt das Prinzip.
Denn Burgtheater war nie ein Stück, das auf Eindeutigkeit setzte. Jelinek selbst konfrontierte das Publikum mit einem Text, der mehr zumutet, als sich in einem einzigen Durchgang begreifen lässt. Es scheint, ob absichtlich oder unabsichtlich, dass eine Übertragung ins Visuelle stattgefunden hat: es soll nicht darum gehen „alles“ zu verstehen, sondern auch darum, die Unmöglichkeit der totalen Durchdringung auszuhalten.
Das Team um Milo Rau unternimmt dabei den Versuch, die Vielschichtigkeit von Jelineks Burgtheater zumindest in Ansätzen aufzudröseln – so weit, wie es in zwei Stunden Spielzeit eben möglich scheint. Doch Rau belässt es nicht bei der Collage: Am 8. Mai 2025 wurde das Stück zusätzlich als reine Jelinek-Fassung präsentiert, in Gestalt einer (Ur-)Lesung. Damit erkannte auch er an, dass Burgtheater in seiner ursprünglichen Textgestalt Raum verdient – als akustisches Gesamtkunstwerk, so, wie es einst geschrieben wurde. Die Proben dazu liefen parallel zu den Arbeiten an der Inszenierung: morgens Burgtheater, abends Urlesung oder andersherum oder wie auch immer. Alles eng getaktet. Dass für das Projekt gleich zwei Regieassistenzen hinzugezogen wurden, verweist auf die Dimension des Unterfangens: Nastasia Griese von den Wiener Festwochen und Claus Nicolai Six vom Burgtheater. Gerade in dieser Doppelung liegt eine symbolische Brisanz: Was geschieht eigentlich, wenn zwei Theaterlogiken aufeinandertreffen?
fusion
Es gibt Orte, an denen Welten zusammengeführt werden und in diesem Fall ist einer davon der Burgtheater-Text von Elfriede Jelinek. Im Dezember 2024 begann die Zusammenarbeit zwischen Wiener Festwochen und Burgtheater, die nicht nur Jelineks Stück in die Gegenwart zurückholt, sondern zugleich die unterschiedlichen Theaterlogiken selbst auf die Probe stellt.
Milo Rau sieht Theater nicht bloß als Abbild oder Spiegel der Realität, sondern als Ort, an dem Realität ausdrücklich reflektiert, kritisiert und potenziell verändert werden kann. Als internationales Festival werden mit den Wiener Festwochen Räume geöffnet, in denen Gastspiele, Koproduktionen und Eigenarbeiten zusammengebracht werden, die häufig stark experimentell, politisch oder diskursiv angelegt sind. Die Festwochen verstehen sich als Ort der Verdichtung, der ästhetischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung – oft mit dem Anspruch, Neues, Fremdes oder auch Verstörendes zu präsentieren.
Tommy Hetzel ©
Das Burgtheater hingegen ist ein permanentes Ensembletheater mit einer langen Tradition als "Nationalbühne". Dort herrscht ein anderer Produktionsmodus: kontinuierliche Probenprozesse, ein festes Ensemble mit etablierten Hierarchien, ein Repertoirebetrieb und ein Publikum, das mit bestimmten ästhetischen Erwartungen kommt. Raus Theaterideale kollidieren oft mit Realitäten, eine davon ist die BURG.
Wenn nun der Intendant der Wiener Festwochen zwischen Festwochen und Burgtheater vermittelt, prallen also nicht nur zwei ästhetische Produktionsweisen aufeinander, sondern zwei kulturpolitische Selbstverständnisse. Festivals stehen für Internationalisierung, für temporäre Intensität, für die „Festivalisierung“ der Kultur, die in den letzten Jahrzehnten oft als Motor ästhetischer Innovation begriffen wurde. Nationalbühnen wie das Burgtheater hingegen verkörpern Dauer, Repräsentation, Traditionspflege – mit all der Schwere, aber auch mit dem Anspruch, gesellschaftliche Selbstbilder zu stabilisieren.
Eine dokumentarische Collage
Rau knüpft an dieser Bruchstelle an. Mit seinem dokumentarischen Zugriff und dem Prinzip der Collage löst er das Stück von der musealen Aura einer „unantastbaren Tradition“ und macht sichtbar, wie fragil solche Kontinuitäten sind. Indem er Jelineks Text mit weiteren Fragmenten, Stimmen und Bildern verschränkt, legt er offen, dass Theatergeschichte kein ungebrochenes Erbe ist, sondern ein Geflecht aus Widersprüchen, Verschweigen und Überlagerungen. Wo Jelinek gegen die „Tradition der unreflektierten Übernahme“ anschreibt, übersetzt Rau diese Geste ins Bühnengeschehen selbst: er zerlegt, montiert und zwingt das Publikum, in den Rissen zwischen Historie und Gegenwart Stellung zu beziehen.
Es gibt jedoch auch künstlerische Vorbehalte gegenüber dem Intendanten: Kritisiert wird seine Neigung zur ausschweifenden Selbstinszenierung sowie zu idealisierenden Heilsversprechen an die Theaterkunst, wie sie etwa in der „Republik der Liebe“ zum Ausdruck kommen. Im Mai dieses Jahres reagierten Sophie Stadler und Sandro Huber mit einer Parodie: Festwochen ohne Grenzen hieß ihr Konzeptstück, das sich als Abrechnung mit Raus Intendanz verstand. Der Klappentext versprach „Das ganze Programm an einem Abend — Ohne Kinderchor“. Wie sich dieses Spannungsverhältnis in Zukunft entwickeln wird, bleibt abzuwarten, immerhin feiert das Festival kommendes Jahr sein 75-jähriges Jubiläum.
Nächste Termine: Freitag 03.10.2025, Sonntag 12.10.2025