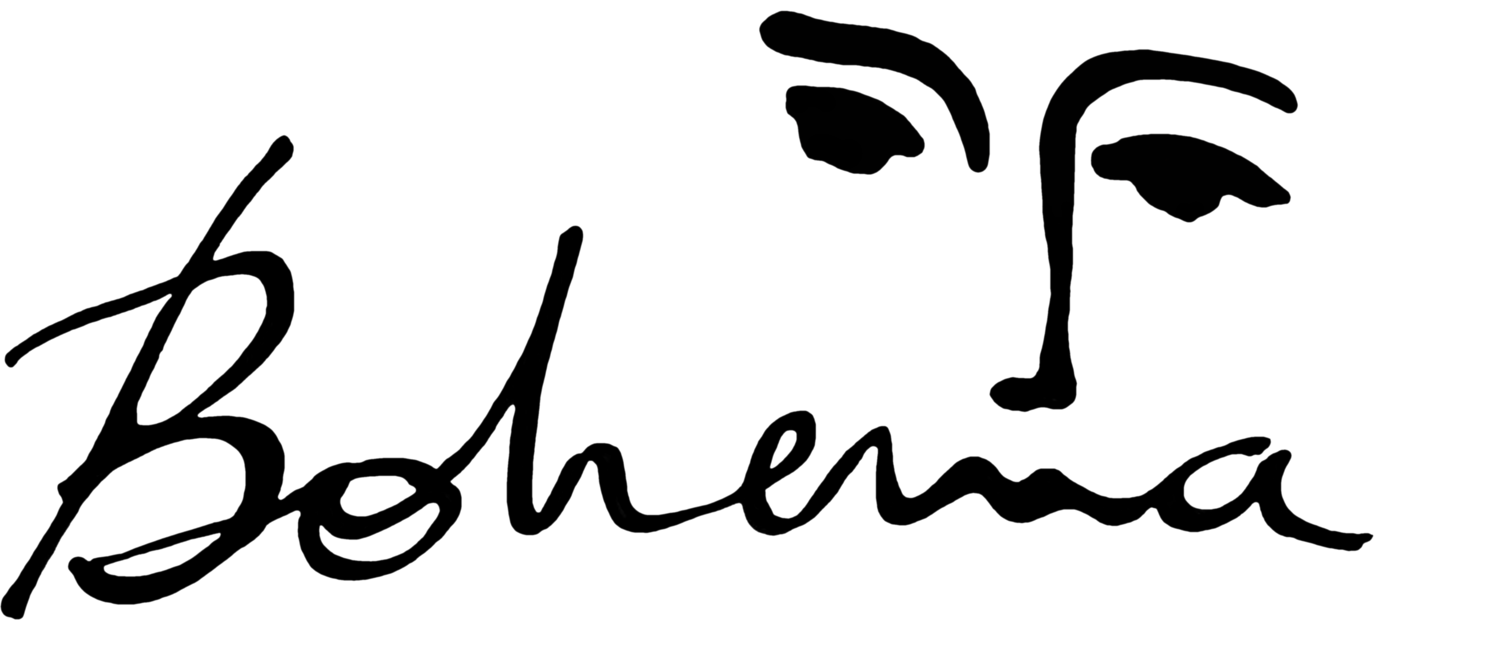Arbeit und Struktur
Als sein Leben plötzlich dem Ende zusteuert, weil ein Hirntumor das Lenkrad seines Lebens umreist, macht Wolfgang Herrndorf, das, was wenige an seiner Stelle tun würden: einfach so weiter wie bisher.
Trigger Warnung: Suizid
Selbstbildnis Wolfgang Herrndorf (Ausschnitt) /// Wolfgang Herrndorf ©
“Weil, man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich lange.”
Frühjahr, Fußball, Hirntumor
Wir sind im Frühjahr 2010. Italien ist noch amtierender Herren-Fußballweltmeister, Covid liegt noch ziemlich genau eine Dekade in der Zukunft und Wolfgang Herrndorfs Kultroman Tschick ist in seinen finalen Zügen. Doch zwischen Fußballspielen mit seinen Friends und Feedback vom Verlag passieren dem Autor unerklärliche Dinge. Beim Fußball wird er gefoult, obwohl es da gar keinen Gegenspieler gibt. Sein Kopf dröhnt immer öfter, scheinbar ohne Grund. Einige Zeit, nachdem all das beginnt, bekommt er die alles verändernde Diagnose: inoperabler Hirntumor. Über kurz oder lang wird dieser seinen Tod bedeuten. Es gibt keine Heilung, nur ein Hinauszögern. Und was macht Wolfgang Herrndorf in diesem Moment? So weiter wie bisher, solange es sein Körper zulässt. Er braucht Arbeit und Struktur. Die Erfahrungen seines Alltags, wegen oder trotz Krankheit, hält er bis zum Schluss in einem Blog fest, der nach seinem Tod als Buch veröffentlicht wird: Arbeit und Struktur. Ein Rückblick auf einen der wichtigsten Jugendautoren der letzten zwanzig Jahre, der im Juni dieses Jahres 60 geworden wäre.
Gib mir Arbeit und Struktur!
Angeblich wächst die Sentimentalität mit dem Alter, aber das ist Unsinn. Mein Blick war von Anfang an auf die Vergangenheit gerichtet. […] immer wollte ich Stillstand, und fast jeden Morgen hoffte ich, die schöne Dämmerung würde sich noch einmal wiederholen.“ Diese Worte sind der Buchauflage von Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur vorangestellt. Das Zurückschauen auf eine Zeit, die noch einfacher war. Vor dem Erfolg, vor dem Krebs, vor dem Tod. Zwischen absoluter Verzweiflung, Humor im tiefsten Abgrund und stillem Grauen lässt Herrndorf seinen krankheitsgeprägten Gemütszustand wissen. Ein Blog, der eigentlich als Möglichkeit, seine Liebsten upzudaten gedacht war, wird zu einem literarischen Online-Erfolg und zu seinem ersten post mortem Buch.
Der Name des Blogs ist Programm. Wir folgen einem Mann in seinem Alltag, zwischen Roman-Schreiben und einem geregelten Leben, nur gehören zu diesem eben auch eine Chemotherapie und Selbstmordgedanken. Herrndorf beschreibt seine Angst, die Kontrolle über seinen Körper abzugeben. Während der Tumor ihn langsam dem Tod näherbringt, versucht er alles in seinem Leben unter Kontrolle zu halten, sogar die Möglichkeit, dem Tumor zuvorzukommen. Doch nicht immer kann dieses intensive Unterfangen gelingen. So erfahren wir von einer Freundin, die von Herrndorfs Gehirn mit der Angst vor dem nahenden Tod verknüpft wird, da sie offensichtlich emotional ergriffen von der Gesamtsituation ist. Der Kontakt zu ihr wird von jetzt auf gleich abgebrochen, er stellt einen weiteren Freund als Mittler dazwischen. Es ist ihm nicht möglich, mit dieser Frau zu interagieren, ohne Todesangst zu fühlen, nicht mal ihren Namen kann er in die Tastatur tippen, ohne dröhnende Kopfschmerzen zu bekommen.
Doch der Text ist keinesfalls ein von Grund auf trauriger, auch wenn der Anlass einer ist. So gibt uns Herrndorfs Umgang mit seinem Schicksal Einblick in den Humor, den er nicht verliert. Als einer seiner Freunde über die hohen Wellen am Strand sagt: „Da, wenn sie die rote Fahne aufziehen, müssen wir alle sterben … ja, du lachst.“ wird dieser bitterböse Humor im Umgang mit dem Tumor klar. Während für den Freund die Möglichkeit einer Extremsituation mit Todesgefahr einhergeht, kann Herrndorf nur lachen, schließlich ist sein Leben, die Extremsituation und die Todesgefahr Alltag.
Der Text, der Herrndorf über drei Jahre begleitet, ist in der Literatur von Krankheitstagebüchern herausstechend. Es ist keine Geschichte, um auf ein Wunder zu hoffen oder positiv zu bleiben, aber auch kein melodramatischer Versuch, Menschen zu Tränen zu rühren. Es ist der Alltag eines Mannes, eines Autors, der rational mit dem Umstand umgeht, dass er seinem Tod deutlich näher ist als die meisten Menschen. Dieser Umstand brachte dem Blog auch vereinzelt negative Reaktionen ein. Der Journalist Joachim Lottmann implizierte zynisch, dass Herrndorfs Erfolg mit seiner Erkrankung zu tun hätte und von seinem tragischen jungen Tod, der bevorstünde, geprägt sei. Auch die Autorin Juli Zeh machte 2013 mit ähnlichen Aussagen auf sich aufmerksam, als sie in einem Facebook-Post ein fiktives Beispiel aufbrachte, das sich mit der Frage auseinandersetzt, ob Wolfgang Herrndorf möglicherweise gar nicht krank sei, da seine Figuren mit ihm als Privatperson verschwimmen würden. Dass Herrndorf zu diesem Zeitpunkt seit über drei Jahren regelmäßig in Chemotherapien sitzt und nicht einmal drei Monate nach diesem Posting sterben wird, tut für Zeh wohl nichts zur Sache.
Erinnerung an Herrndorf
Schulklassen der letzten 15 Jahre liegt der Name Wolfgang Herrndorf nahe. Tschick ist längst etablierte Lektüre. Die Fahrt von Maik und dem titelgebenden Tschick durch die sommerliche Provinz mit dem gestohlenen Lada kommt zwischen Goethe, Schiller und Mann besonders gut weg. Neben Theaterfassungen, die bereits zu Lebzeiten des Autors aufgeführt wurden, gibt es mittlerweile einen Kinofilm aus dem Jahr 2016, eine Opernversion sowie das multimediale Web-Angebot Tschickucation, wo Materialien zu Herrndorfs größtem Erfolg gesammelt werden. Die Person Wolfgang Herrndorf hat sich längst in das kollektive Gedächtnis des modernen Kanons eingebrannt. Er wird oft nur mit seinem Meisterstück in Verbindung gebracht, doch steckt in seinem Œuvre noch viel mehr. Der letzte zu Lebzeiten fertiggestellte Roman Sand, ein Thriller-Spionage-Krimi, der auch als Parodie gelesen werden kann, oder das posthume Bilder deiner großen Liebe: ein unvollendeter Roman sind dabei nur zwei Beispiele. In zweiterem erfährt man die Perspektive Isas aus Tschick. Wie es der Untertitel beschreibt, bleibt dieser Roman unvollendet. Herrndorf stimmte vor seinem Tod der Veröffentlichung zu, außerdem bestimmte er auch den Titel. Das schreckliche Klischee des talentierten Autors, der viel zu jung stirbt, trifft leider auf Wolfgang Herrndorf zu. Doch die überlebenden Texte zeigen, dass wir ihn nicht nur als das sehen sollten. Arbeit und Struktur prägt dabei die Anschauung auf Herrndorf und seine Normalität im Umgang mit der Krankheit. Tschick zeigt sein Verständnis für den Jugendroman und seine kreative Energie, die wohl noch viele erwähnenswerte Romane erschaffen hätte.
„Weil, man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich lange.“ (Tschick, S. 254)
“15.07.2013 23:12
Niemand kommt an mich heran
bis an die Stunde meines Todes.
Und auch dann wird niemand kommen.
Nichts wird kommen und es ist in meiner Hand.“”
Wolfgang Herrndorf stirbt im Alter von 48 Jahren am 26. August 2013 durch einen Suizid. Im Arbeit und Struktur-Nachwort wird von Hinterbliebenen beschrieben, dass sein Körper wenige Tage später nachgegeben hätte. Am 12. Juni 2025 wäre Wolfgang Herrndorf 60 Jahre alt geworden.