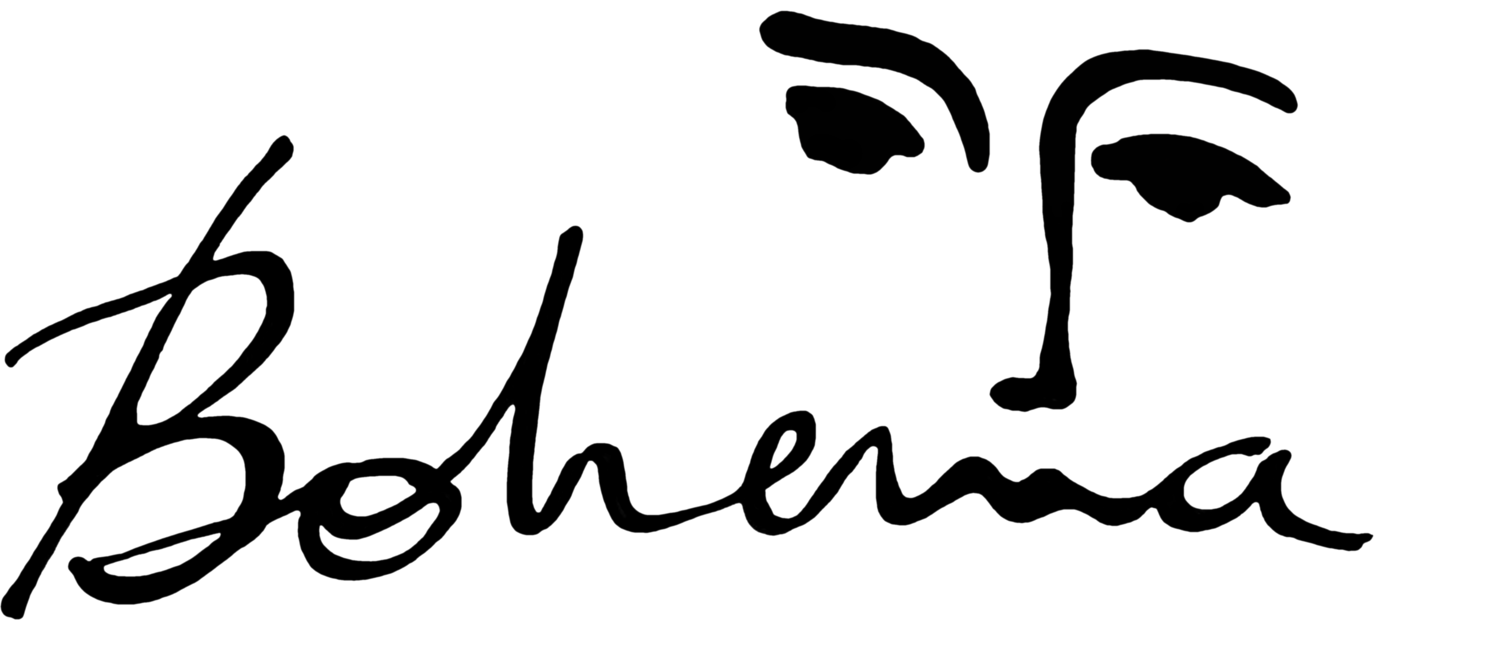Wien schaut anders: Filmkultur in Bewegung
Ein Gastbeitrag über den Status Quo der Wiener Kinokultur von Julian Stockinger (u.a. Kurator beim Freiluftkino Frameout sowie der Nachtblende im Gartenbaukino)
© Viennale / Robert Newald
„Sommerkinos ohne Programm“ heißt ein am 11. Juli erschienener Text von Patrick Holzapfel auf „Jugend ohne Film“. Darin unterstellt der Autor den Programmen der Sommerkinos, die dieser Tage in allerlei Städten aufgepoppt sind, eigentlich gar keine Programme zu sein: „Im Freiluftkino wurde der wiederkehrende Zuschauer aufgegeben. Das einzelne Erlebnis zählt, nicht das Gefühl, an einer Auseinandersetzung mit dem Leben oder der Kunst teilzuhaben, die sich über mehrere Filme streckt. […] Größere Programmbögen sucht man heute überall mit der Lupe“.
Unabhängig davon, ob und inwiefern der von Holzapfel beschriebene Zustand problematisch ist, und ob und inwiefern sein Text ein bisschen zu spaßbefreit ist, stellt sich zunächst die Frage, ob es das von Holzapfel kritisierte Phänomen nicht schon immer gab. „Ein Date, ein bisschen Abkühlung unter Sternen oder unter Mücken. Ein Abendessen und danach ein Film“, schreibt er und irgendwie kommen da schnell verklärte Bilder eines lauten, Popcorn essenden Publikums in den 50er-Jahren in den Sinn. Oder US-amerikanische Autokinos, bei denen Holzapfels Unterstellung, man solle „sich nicht ins Kino verlieben, sondern im Kino verlieben“, seinerzeit nicht nur toleriert, sondern regelrecht zelebriert wurde. So sehr, dass die dort laufenden B-Movies alle paar Minuten nackte Haut oder Gewalt zeigen mussten, um das knutschende Publikum zumindest ein bisschen an sich zu binden.
Das Kino, das Ende des 19. Jahrhunderts als Attraktion auf Jahrmärkten das Licht der Welt erblickte (und der Welt ein unabdingbares Licht schenkte) gab es bekanntlich nie fernab kulturindustrieller – vulgo kapitalistischer – Verwertungslogik. Und auch heute steht und fällt der Betrieb mit den zahlenden Besucher:innen. Leer bleibende Kinos werden früher oder später schließen müssen, seien sie noch so sehr staatlich gefördert und das Programm noch so schön kuratiert. Nur scheint sich aktuell in den Kinosälen etwas zu bewegen, was ein gewisses Potential birgt. Von dieser Bewegung ausgehend kann Holzapfels Kritik – nicht nur am Sommerkino, sondern am Kinoprogramm im Allgemeinen – weitergedacht werden.
Zeiten der Apps und Abos
Es muss angemerkt werden, dass hier aus einer Wiener Perspektive geschrieben wird, von wo man sich derzeit – so scheint es – keine Sorgen machen muss. Zumindest nicht um die sogenannten Programmkinos. Die verzeichnen nämlich seit spätestens letztem Jahr Rekordzahlen. Das liegt vermutlich an unterschiedlichen Entwicklungen, von denen zwei hervorzuheben sind: Das nonstop Kinoabo, das Abonnent:innen seit 2023 ermöglicht, für wenig Geld quasi nonstop ins Kino zu gehen und eine wachsende Generation an filminteressierten Menschen mit Letterboxd-App am Handy (auch ein Umstand, dem Holzapfel schonmal einen Text gewidmet hat). Weil diese neue Generation ältere Filme nicht scheuen dürfte, sondern ganz im Gegenteil, an Filmgeschichte interessiert zu sein scheint, setzen jetzt fast alle Kinos vermehrt auf "Klassiker".
Dadurch entsteht eine interessante Dynamik. „Herkömmliche“ Programmkinos, die sich bis dato fast ausschließlich aktuellen Kinostarts widmeten, stürzen sich auf Reihen mit älteren Filmen. Oft ist es nicht nur der Film, der geboten wird: Passende Drinks, DJs, Dresscode oder den Aufruf das Strickzeug einzupacken gibt es obendrauf. "Das Kino (und das ist leider keine Sache der Freiluftkinos allein) feiert sich selbst als sozialen Ort und vergisst dabei, dass es Filme zeigt", heißt es bei Holzapfel. Und es ist tatsächlich ärgerlich, dass das Kino heute gefühlt immer mehr sein muss als Kino. Diese Überbetonung vom sozialen Ort (was konkret soll das eigentlich sein?) und die gleichzeitige Tendenz der Eventisierung hat nicht nur etwas peinlich Gezwungenes, es scheint gar möglich, dass es dem Kino nachhaltig schadet. Weil es nicht ernst genommen wird. Der Fokus wird vom Genuinen auf den Zusatzaspekt gerichtet: Vom Film im Kino auf alles andere im und ums Kino. Und das nicht einmal dreist-ehrlich, wie es etwa das US-amerikanische Autokino tat, sondern irgendwie heuchlerisch, weil die Liebe zum Kino immer vorangeschoben werden muss, um das dahintersteckende Businessmodell zu verdecken. Das alles wird dem Film als Kunstform und dem Kino als theoretisch unerschöpfliche Quelle der lustvollen Auseinandersetzung mit Film nicht gerecht. Und auch nicht dem wachsenden, kinobegeisterten Publikum.
Wobei hier nicht der Anschein erweckt werden soll, jedes Kino-Event, das mehr ist als Film, sei dem Kino nicht würdig. Das wäre natürlich Quatsch. Es gibt wunderschöne Symbiosen aus Event und Film, bei denen zweites dennoch das zentrale Element bleibt. Und es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass es ein vermutlich gar kein kleines Publikum für derlei Events gibt und dass es absolut legitim ist, diesem etwas zu bieten. Aber es gibt eben auch das andere, das wissbegierige und filmenthusiastische Publikum, für das das Kino und sein Programm nach wie vor ein weites, längst nicht ausgeschöpftes Feld voller Möglichkeiten ist.
Fenster zum Lichthof
Vielleicht tut sich hier in Wien gerade eine Art "Window of Opportunity" auf, das ermöglicht, den ewigen Kreislauf der Beschwörung des Kinotodes zu durchbrechen. Die Verantwortung dafür würde jedenfalls auch bei den Kinobetreiber:innen liegen. Es ist vorstellbar, dass es einem Teil des Publikums schon bald zu langweilig wird, sich wieder in den naheliegendsten Film zu setzen, sich wieder einer algorithmischen Logik der Filmwahl hinzugeben. Jetzt scheint es noch zu funktionieren, dieses Modell, indem die immergleichen “Klassiker” kursieren: Ein bisschen Mood for Love hier, etwas Verachtung da und den obligatorischen Varda/Denis obendrauf. Als gäbe es keine anderen älteren Filme von Frauen. Aber wie lange wird das noch gut gehen? Und selbst wenn, darf es vielleicht trotzdem ein bisschen mehr sein?
Eine nachhaltige Trendwende in der Wiener Filmkultur, die auch die Art wie über Film gesprochen und geschrieben wird, beeinflusst und die es vermag, kommende Generationen anzustecken, wäre vielleicht möglich, wenn es im Kino weiterhin etwas zu entdecken gäbe. Wenn das Kino dem Publikum einen Schritt voraus wäre, statt sich immer nur auf den nächstbesten Crowdpleaser zu stürzen. Es soll hier keine wirkliche Hierarchie beschwört werden, aber zwischen elitärer Überheblichkeit und purer Service-Dienstleistung gibt es einen Spielraum. Dieser könnte mit einzelnen Filmen bespielt werden, aber natürlich auch mit der Art, wie sie „miteinander oder gegeneinander oder auseinander hervorgehend“ (Holzapfel) programmiert werden, was sich bei “historischen Programmen” anbietet. Aber dafür braucht es Zeit.
Zeit, die in den meisten Kinos fehlt. Deswegen ist es nur verständlich, dass bei der Programmgestaltung zu schnell zu jenen Filmen gegriffen wird, die sich aufdrängen oder schon zigfach bewährt haben. Es gibt kaum Kurator:innen, die neben dem Programm nicht für mindestens ein Dutzend weitere Tätigkeiten zuständig sind. Die Programmgestaltung bleibt dadurch nur ein Ding von vielen, das erledigt gehört. Das merkt man. Aber muss es so sein?
Die Zeiten scheinen sich geändert zu haben, zumindest in Wien. Das Kino braucht keine Rechtfertigungen und keine Erklärungen mehr. Es braucht keine Pseudo-Anreize, um Publikum zu generieren. Zumindest nicht mehr, als es Programme mit Substanz braucht. Von Menschen, die sich Zeit nehmen, neue Perspektiven zu schaffen und die den Film ins Zentrum stellen. Jetzt wäre der Moment, das auszuprobieren, der Moment zu experimentieren. Denn jetzt geht es dem Kino gut. Die Frage ist, wie lange noch.