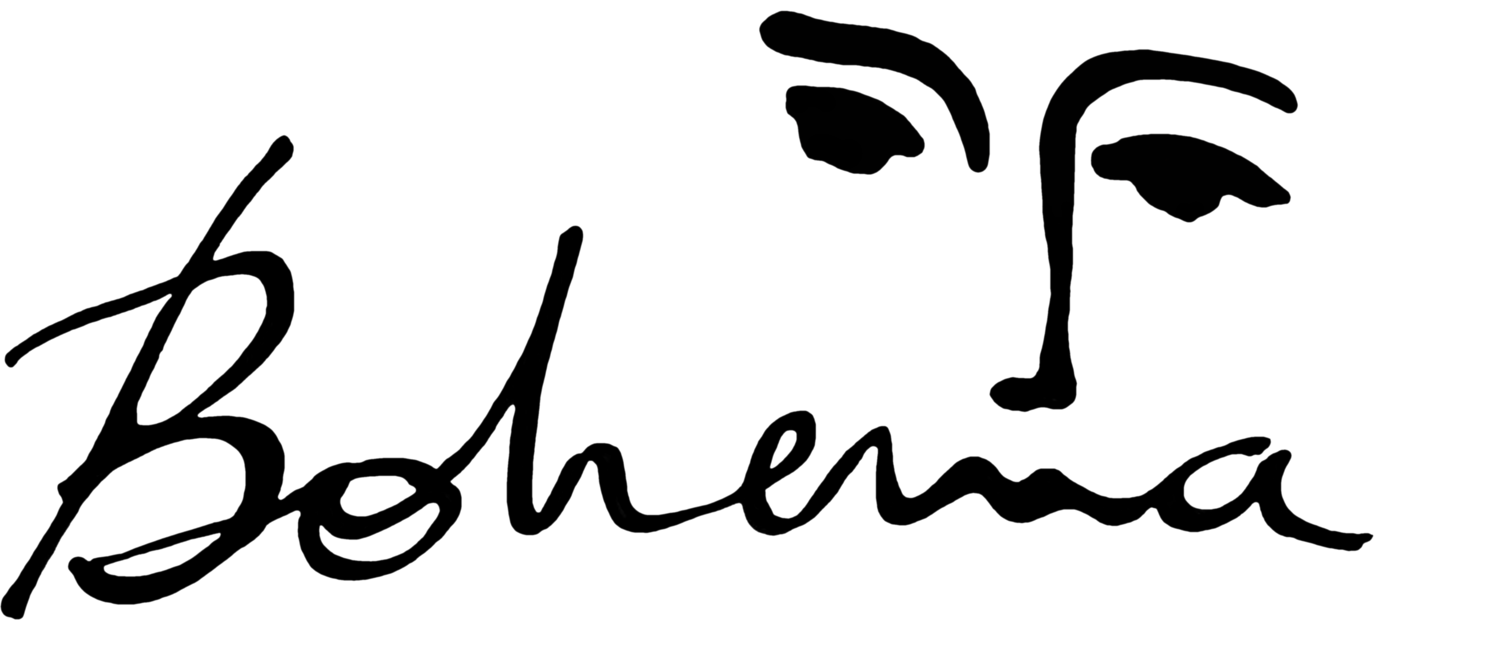Väter, Mütter, Nostalgie
Kurzkritiken zu drei Viennale-Filmen von ‘Altmeistern’ Jim Jarmusch und Linklater
Linklaters Nouvelle Vague: Nostalgische Staubschicht über revolutionärem Geist /// © Netflix
Father Mother Sister Brother: Handzahme Familienportraits
In Jim Jarmuschs neuestem Film Father Mother Sister Brother offenbart sich eine sich schon lange abzeichnende Wendung im Schaffen des einstigen Independent-Wunderkinds. Filme die einst durch skurrile Figuren und unkonventionelle Erzählweisen bestachen, präsentieren sich nun als gutbürgerliche Kritik am Bürgertum selbst – ein Paradox, das den Film durchzieht und seine Wirkung schmälert.
Die ersten beiden Vignetten des Films zeigen Familienporträts, die zwar durchaus amüsante Momente bieten, dem Genre des dysfunktionalen Familiendramas jedoch nichts Neues hinzufügen. Jarmusch bedient sich bekannter Muster: unterdrückende Mütter, toxische Väter und Kinder, die verzweifelt um Anerkennung wetteifern. Die Darstellungen, insbesondere bei Vicky Krieps und Cate Blanchett, wirken dabei merkwürdig aus der Zeit gefallen. Das klischeehafte Gegenüberstellen der Revoluzzerin und der Braven, um dann zu enthüllen, dass beide menschlich sind und ihre eigenen Probleme haben, ist dermaßen vorhersehbar und platt, dass man sich nur wundern kann.
Der Film oszilliert zwischen Altersmilde und einem gewissen Boomer-Zynismus, der sich in einem Humor manifestiert, bei dem das Publikum sich selbst auf die Schulter klopfen kann – gerade nicht unangenehm genug, um wirklich zu provozieren. Gleichzeitig tauchen auch Einschübe von einer seltsamen Romantisierung der Jugend auf: Stichwort SkateboarderInnen. Visuell greift Jarmusch auf vertraute Elemente zurück, etwa die klassischen Einstellungen aus Coffee and Cigarettes. Doch während der Tisch dort noch Bühne für philosophische Gespräche und skurrile Begegnungen war, dient er hier lediglich als Ablage für eine eher langweilige Bürgertumskritik.
Die dritte und letzte Vignette bildet jedoch einen bemerkenswerten Kontrapunkt. Hier arbeitet Jarmusch bewusst gegen die etablierten Konventionen der vorherigen Episoden und offenbart wieder jene Liebe zu seinen Figuren, die wir aus seinen früheren Werken kennen. Die Geschichte von Zwillingen, verbunden durch ihre Ähnlichkeit trotz unterschiedlicher elterlicher Erziehung, transzendiert die simple Dichotomie von Natur versus Erziehung. Stattdessen anerkennt Jarmusch hier die Komplexität von Sozialisierung. Diese Episode zeigt keine absolute Versöhnlichkeit mit der Vergangenheit, kein reines nostalgisches Schwelgen, sondern tatsächliche Reflexion und eine Form von Zufriedenheit.
Father Mother Sister Brother hinterlässt letztlich einen zwiespältigen Eindruck. Während die ersten beiden Teile in ihrer konventionellen Familienkritik verharren, zeigt die abschließende Episode, dass Jarmusch durchaus noch zu jener Ambivalenz fähig ist, die sein früheres Werk auszeichnete. Es bleibt die Frage, ob diese Momente ausreichen, um den Film als Ganzes zu tragen.
Nouvelle Vague: Nostalgische Staubschicht über revolutionärem Geist
Richard Linklaters neuer Film Nouvelle Vague präsentiert sich als nostalgische Hommage an eine der einflussreichsten Bewegungen der Filmgeschichte, verfehlt jedoch dabei deren revolutionären Geist. Was als liebevolle Würdigung Jean-Luc Godards und seiner Zeitgenossen beginnt, entpuppt sich als allzu zahme und konventionelle Auseinandersetzung mit einer radikal unkonventionellen Kunstrichtung.
Der Film trägt unverkennbar Linklaters Handschrift und versprüht den charakteristischen Charme seiner Werke. Seine große Zuneigung zu den Figuren ist spürbar und verleiht dem Film eine gewisse Wärme. Doch genau hier offenbart sich eine zentrale Schwäche: Die Charaktere verkommen zu wandelnden Kalendersprüchen und Glückskeksweisheiten. Man könnte dies als subtile Kritik an Godards Intellektualismus interpretieren, doch diese Lesart greift zu kurz. Letztendlich sind alle Figuren von Godard begeistert und huldigen dem wahren Künstlergenie – eine Herangehensweise, die paradigmatisch für die problematische Auteur-Theorie steht, die allzu oft in einen unkritischen Geniekult mündet.
Die humoristischen Elemente des Films nutzen sich schnell ab. Der immer wiederkehrende Gag über Godards unkonventionelle Methoden und seine vermeintlichen Weisheiten wird nach einer Weile ermüdend. Was anfangs noch charmant wirkt, verliert durch die ständige Wiederholung an Wirkung. Der Ernst und die künstlerische Radikalität, die die tatsächliche Nouvelle Vague auszeichneten, werden unter einer dicken Schicht von Charme und Nostalgie begraben.
Besonders problematisch ist Linklaters Darstellung Godards als monolithische Figur. Der Film konzentriert sich ausschließlich auf Godards Nouvelle-Vague-Phase und seine Anfänge, dabei war Godard stets das genaue Gegenteil einer festgeschriebenen Künstlerpersönlichkeit. Wie Bob Dylan ließ er sich nie festlegen – es gab nicht einen Godard, sondern Dutzende. Seine Wandelbarkeit und sein enigmatischer Charakter, die seine Werke so faszinierend machen, werden hier zugunsten einer vereinfachten Erzählung geopfert.
Für einen Film über das Filmemachen ist die formale Gestaltung erstaunlich konventionell und handzahm. Während Godard mit radikalen Formen experimentierte und die Grenzen des Mediums austestete, bleibt Linklater in sicheren, etablierten Mustern verhaftet. Dass der Film mit erklärenden Texttafeln endet, die historischen Kontext bieten, steht in direktem Widerspruch zu Godards Ideen vom Filmemachen – ein ironischer Schlusspunkt für eine Hommage, die ihrem Gegenstand nicht gerecht wird.
Nouvelle Vague ist letztendlich ein Film, der die revolutionäre Kraft seiner Vorlage durch nostalgische Verklärung entschärft. Linklater gelingt es nicht, die Spannung zwischen Verehrung und kritischer Auseinandersetzung produktiv zu nutzen. Was bleibt, ist ein zahmes Hommage-Kino, das die radikale Energie der Nouvelle Vague in wohltemperierte Nostalgie verwandelt.
Selbstzerstörerischer Geniekult: Blue Moon
Richard Linklaters Blue Moon offenbart den Regisseur einmal mehr als belesenen Nostalgiker, der tief in der kulturellen Geschichte Amerikas und des Films verwurzelt ist. Doch während Linklater oft dazu neigt, das Revolutionäre seiner Sujets hinter einer verklärenden Patina zu verbergen, positioniert er sich in seinem neuesten Werk überraschend deutlich auf der Seite des Kritischen und Satirischen. Der Film porträtiert Lorenz Hart, die eine Hälfte des legendären Songwriting-Duos Rodgers und Hart, als einsamen Hedonisten, der in seiner queeren Identität eine tragische Größe findet.
Das als Kammerspiel inszenierte Drama dokumentiert einen Absturz in die eigene Obsoleszenz. Hart, verkörpert von Ethan Hawke, erscheint als eine der letzten großen Figuren einer untergehenden Ära – ein Genie, das keineswegs dem klassischen Männlichkeitsideal entspricht, aber dennoch dem problematischen Geniekult dieser Zeit verhaftet bleibt. Die Nostalgie, die Linklater hier beschwört, ist durchzogen von einer kritischen Ambivalenz, die den Film vor allzu simplen Verklärungen bewahrt.
Besonders deutlich wird diese Zwiespältigkeit in der Darstellung von Harts Verhalten gegenüber der von Margaret Qualley gespielten jungen Frau. Die Anhimmelung der Zwanzigjährigen durch den deutlich älteren Hart wirkt verstörend, und es stellt sich die Frage, ob Linklater diese Unangemessenheit bewusst inszeniert oder ob sie als unbeabsichtigter Nebeneffekt einer zu starken Bewunderung für seine Hauptfigur entsteht. Die Männergespräche des Films wirken aus heutiger Perspektive befremdlich anachronistisch. Während dies einerseits einem historischen Realismus geschuldet ist, versäumt es der Film stellenweise, diese Momente ausreichend zu kontextualisieren.
Interessanterweise übt der Film auch Selbstkritik an seinem eigenen Regisseur. Wenn Hart sich abfällig über die inflationäre Verwendung von Ausrufezeichen im Musical Oklahoma! äußert, kann man dies als augenzwinkernden Seitenhieb auf Linklaters eigenen Film Everybody Wants Some!!! mit seinen drei Ausrufezeichen lesen. Solche Momente der Selbstreflexivität durchbrechen die nostalgische Schwärmerei und verleihen dem Film eine zusätzliche kritische Dimension.
Hawke navigiert in seiner Darstellung meisterhaft zwischen den Polen von Mitleid, Bewunderung und Abscheu. Hart erscheint als anstrengende, überlebensgroße Persönlichkeit, deren selbstzerstörerische Tendenzen nachvollziehbar machen, warum sein Partner Richard Rodgers schließlich einen Schlussstrich ziehen musste. Diese Vielschichtigkeit verhindert, dass der Film in reine Hagiographie abdriftet.
Blue Moon ist letztlich ein Film voller Trauer, der nostalgisch ist, ohne in Konservativismus zu verfallen. Die implizite Kritik an den vermeintlich guten alten Zeiten durchzieht das Werk wie ein roter Faden – selbst Filmklassiker wie Casablanca bleiben nicht von Harts scharfzüngigen Kommentaren verschont. In dieser Balance zwischen Bewunderung und Kritik, zwischen Sehnsucht und Ernüchterung findet Linklater einen Ton, der der Komplexität seines Sujets teilweise gerecht wird, auch wenn der Film nicht alle seine problematischen Aspekte vollständig zu reflektieren vermag.