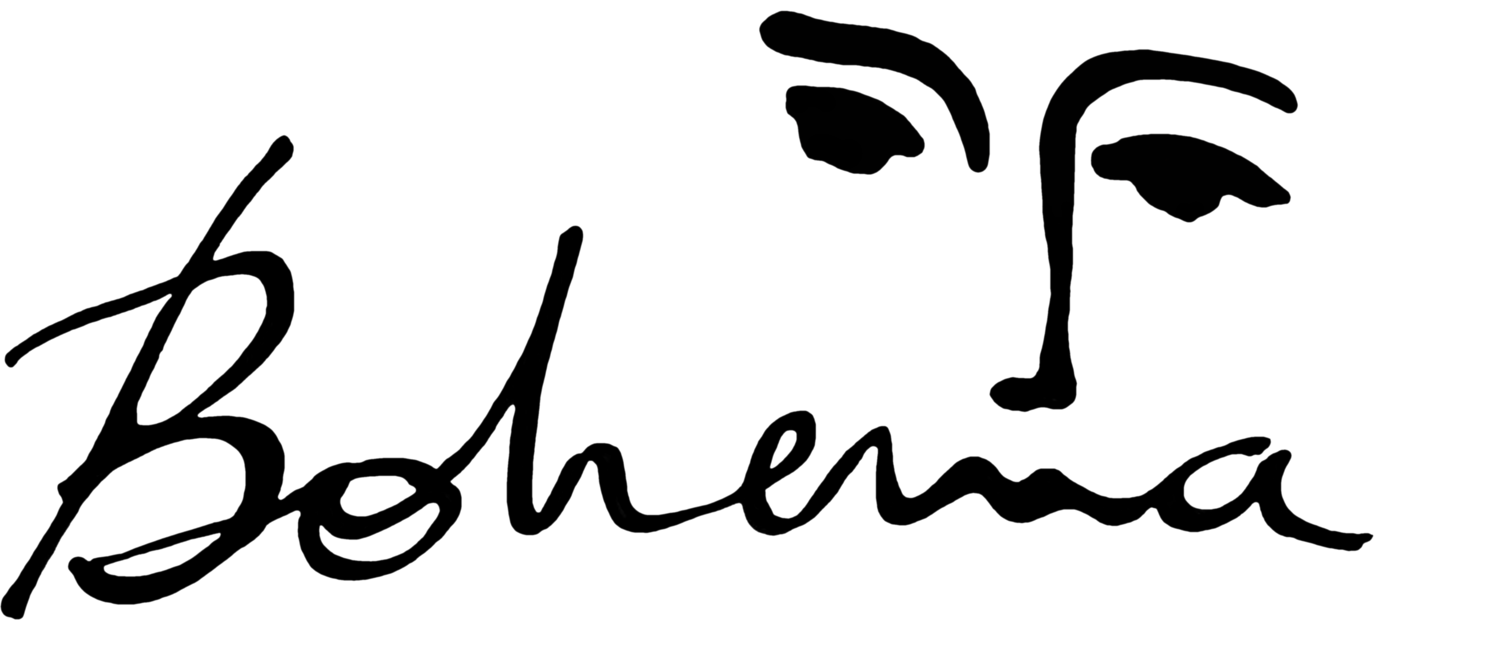Wenn die Berge sprechen könnten, würden sie schweigen
Grüß Gott und du bist tot: in Heimsuchung wird das Patriachat exorziert – ein Gespräch mit Regisseurin Sarah Held über einen Film, der so verstören will, wie Femizide es eigentlich sollten.
© Photo: eSeL.at – Joanna Pianka
Was tun, wenn sich das Böse nicht vertreiben lässt, weil es Teil der Tradition ist? In Heimsuchung ist das Grauen nicht übernatürlich – es ist vererbt, verdrängt und gesellschaftlich akzeptiert. Jedes Jahr sterben Frauen durch Männerhand. Femizid ist kein Einzelfall, sondern ein Echo, das durch Generationen hallt.
Bohema/Maja Jakovac: Also zuerst möchte ich dich fragen, da Heimsuchung, wie es auf der Seite des Gartenbaukinos heißt, der einzige Drecksheimatfilm ist, wie es denn zu diesem Titel kam, wie die Idee entstand und wer wen heimsucht? [Der Drecksheimatfilm ist das Gegenstück zum Heimatfilm, dessen heile Welt er dekonstruiert, dabei gesellschaftliche Gewaltverhältnisse in ländlichen Strukturen aufdeckt und Heimat nicht als Trost, sondern als Tatort zeigt.]
Sarah Held: Der Film ist ein Kunstfilm und er ist entstanden aus der Performance, die wir (der Aufstand der Schwestern) 2023 in Tamsweg gemacht haben. Tamsweg ist insofern ein Ort, der für uns spannend und wichtig war, weil es im Salzburger Lungau des späten 17. Jahrhunderts, als das europäische Festland eigentlich kapiert hat, dass Inquisitionen nicht so geil sind, abgesehen von ein paar entlegenen Regionen (Österreich, Teile von der Schweiz, deutsche Friesische Inseln...) dort noch einmal einen starken Peak gab. Das hat uns interessiert. Ich bin auf dieses Thema gestoßen, als ich als junge Doktorandin — ich habe in der Kunst promoviert, aber auch zu Film gearbeitet — bei einer Tagung zu österreichischen Exploitationfilm im Subgenre Witchploitation war und die Filme Hexen bis aufs Blut gequält (1970) und Hexen geschändet und zu Tode gequält (1937) gesehen habe. Die wurden genau dort gedreht, wo wir auch gedreht haben. Ich wollte einfach diese Idee feministisch neu schreiben. Es gab dann drei Orte; einmal Schloss Moosham, wo die peinliche Befragung und Folter stattfanden. Den Markplatz, wo Schau prozessiert wurde. Den gerodeten Hügel Passeggen, wo man schon von Weiten geräderte und gequälte Menschen gesehen hat. Also schon ein Spektakel, das wir neu bespielen wollen.
B: Die ganze Ästhetik des Filmes ist interessant, wie kommt es dazu?
S: Die Basis ist ja die Perfomance und da war es so, dass es uns wichtig war, einen klassischen naming-names- Habitus zu vermeiden. Also, dass wir quasi den Namen des Schlächters vermeiden, weil ich es generell wichtig finde, im Zuge von vergeschlechtlichter Gewalt die Täternamen nicht ständig zu wiederholen, da sie sich ihre eigene Legacy schaffen. Der Täter ist recht bekannt, er gehört zu einem ganz klaren Sagenkorpus aus dem Salzburger Lungau Land. Alle wissen, wie er heißt, wo er gewohnt hat und dass er Richter und Sadist war. Niemand aber kennt die Namen der Frauen. Wir haben uns bei der Performance gedacht, wir rufen unsere Ahnenfrauen an und befreien sie.
B: Bei der Performance stecht ihr sozusagen in ein Kostüm ein – für was standen die „Bubbles“?
S: Jede Bubble im Kostüm, die man am Markplatz bei dieser Gore-Szene sieht, stand für die Befreiung einer Ahnenfrau. Es sind insgesamt 23 Stück. Für jede Frau haben wir dem Typen eine Last herausgestochen.
© Sarah Held und FAZO666FAZO
B: Ist das ein Akt der Selbstermächtigung? Wie hat es sich angefühlt?
Totale Katharsis. (lacht) Total gut. Deswegen mach ich das ja auch. Ich arbeite relativ viel zu gesellschaftlichen Missständen, zu Rechtsextremismus oder auch zu Gewalt, die von Männern ausgeübt wird. Das hat eine gewisse Schwere mit sich. Mit geht’s darum, welchen Beitrag Kunst auf einer gesellschaftlichen Ebenen leisten kann, wenn wir mit unseren Performances bekräftigende Momente, Momente der Unentrinnbarkeit schaffen. Wir gehen dann raus und zerschlagen dann zum Beispiel Satanas Patriachanas in Form von einer Büste am Karlsplatz mit Morgensternen. Das bricht einerseits mit der Sichtachse von einer Demonstration, dass heißt, wenn ich mich hinstelle und einen Vortrag halte, eine Kundgebung mache, dann ist das Teil von der Doxa. Das ist, wenn man mit Bourdieu spricht, etwas, das in den Alltag gehört, das Leute immer wieder sehen. Wenn man das aber mit Aktionskunst im öffentlichen Raum verbindet und dadurch Leute, die eigentlich nicht zu einer feministischen Performance kommen würden, auf einmal mit dem Thema in Berührung bringt und miteinander spricht… das ist, was wir wollen.
B: Im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema Femizid, habe ich mich gefragt, was denn den Femizid vom herkömmlichen Mord unterscheidet?
S: Es gibt verschiedene Annährungen an den Begriff. Wir arbeiten mit unserer Definition des Femizid folgendermaßen; also die vergeschlechtlichen Morde sind insofern von dem regulären Homizid zu trennen, da sie aufgrund von verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen erzeugt werden. Das läuft über drei Gewaltachsen. Wir arbeiten da mit dem Gewaltdreieck nach Johann Galtung aus der Friedens- Konfliktforschung. Gewalt hat drei Achsen, die ein Dreieck bilden. Das eine Eck ist direkte Gewalt, das wäre zum Bespiel alles, was physisch ist. Dann gibt es strukturelle und kulturelle Gewalt und die können zu verschiedenen Formen von direkter Gewalt führen. Wie zum Beispiel zum Femizid, Sexismen, verschiedene benachteiligende Strukturen, dass Frauen in Abhängigkeitsverhältnissen leben, je nach Arbeitsstruktur. Also dieser Mechanismus. Dieses Ineinander-Wirken und gleichzeitig verzahnt sein. Das ist das, was wir auch im Femizid sehen; Struktur, aber auch Kultur. Das ist ein Bestandteil, der nicht nur in westlichen Industriekulturen vorherrscht, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen.
B: Glaubst du, dass das Intellektuelle die Leute abschreckt?
S: Sicher. Natürlich. Ich würde jetzt nicht wirklich von einem Abschrecken reden, sondern wenn ich etwas in der Gesellschaft bewirken will; in welcher Weise kann ich das tun? Das ist das, was mich antreibt. Ich habe eine Agency, ich habe eine bestimmte gesellschaftliche Position. Ich bin einerseits Wissenschaftlerin, gleichzeitig bin ich auch durch meine aktivistische und künstlerische Praxis Teil einer Ausdrucksform. Mir ist es wichtig, in welcher Form können wir Beiträge leisten, um von einem Ist-Stand zu einem progressiven Zustand zu kommen, der im Sinne einer gerechteren Klassengesellschaft funktioniert. Femizid ist eine intersektionale Geschichte, da wirkt Sexismus mit, da wirkt Rassismus mit und es gibt nicht den einen Grund für Femizide. Das ist ein Geflecht mit unterschiedlichen Benachteiligungen und Begünstigungen.
B: Dann gibt es ja noch den Feminizid – was ist da der Unterschied zum Femizid?
S: Es gibt verschiedene Ansätze zum Unterschied. Der Feminizid unterscheidet sich vom Femizid, indem beim erst genannten noch die Rolle des Staates mitgedacht wird. Wir verzichten darauf, weil wenn man fragt „was ist approachable?“ „was ist ein akademischer Begriff?“, wenn man zum Beispiel nach Tamsweg fährt und dann dort mit den Leuten redet, dann ist Feminizid schon ein schwieriges Wort. Deswegen denken wir in unserer Definition die Rolle des Staates in struktureller Gewalt mit.
B: Was glaubt du, woran liegt es, dass diese Form der tödlichen Gewalt nicht denselben Aufschrei in der Gesellschaft hervorruft wie andere Gewaltverbrechen?
S: Da gibt es ein gutes Beispiel. Vor ein paar Monaten ist irgendwo in Oberösterreich ein Jäger durchgedreht und hat angefangen, Leute zu erschießen. Ich habe mir gewünscht, dass ein Femizid mal so einen Aufschrei hervorruft und so eine schnelle Reaktion von Seiten der staatlichen Organe. Einer der Unterschiede ist, dass man daran gewöhnt ist. Es ist Teil eines Narrativs, es gehört zum Alltag dazu. Solange Gesellschaft daran gewöhnt ist, passiert nichts.
© Sarah Held und FAZO666FAZO
B: Ist das Verstören ein Weg dorthin oder in anderen Worten: soll Heimsuchung ein verstörender Film sein?
S: Ja, auf ganz vielen Ebenen. Es soll ja auch Spaß machen. Es ist ein Film, den ich mit ganz vielen tollen Leuten und einem sehr guten Freund von mir, dem Fazo, zusammen gemacht habe. Es ist unsere Ausdrucksform. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Dinge thematisieren kann. Über Wissenschaft, Vorträge, Aktivismus und eben über Film. Dieser Film macht etwas Spannendes, er nimmt ein Thema, das unerträglich ist und packt das in ein total weirdes Packet zusammen.
B: Was wünscht du dir von den Zuschauenden?
S: Mir geht es darum, dass sich Leute ihrer eigenen Handlungsmacht bewusst sind. Dass jede Person in irgendeiner Form einen Beitrag leisten kann. Das hängt natürlich von Ressourcen ab. Du brauchst Zeit, du brauchst Nerven, du brauchst finanzielle Mittel, Wissen und Zugang. Du kannst zum Beispiel, wenn in der U-Bahn eine Frau von einem Typen dumm angemacht wird, aufstehen und eingreifen. Es gibt kleine Mikroakte mit Zivilcourage. Das würde ich gerne anregen.
B: Jetzt möchte ich noch eine Verbindung ziehen. Ihr habt 2021 ein pinkes Holzkreuz durch Wien getragen und 31 Nägel reingeschlagen – was ist da der Ursprung?
S: Die Farbe Pink ist eine Einschreibung in internationale Kämpfe gegen vergeschlechtlichte Gewalt und Femizide. Die Farbe und das Kreuz haben den Ursprung in Ciudad Juárez. Da wurden in den frühen 90er Jahren für vermisste und ermordete Frauen pinke Kreuze aufgestellt. Das pinke Kreuz ist zum Widerstandssymbol geworden. Pink hat eine interessante Historie. Pink wird aus der Purpurschnecke hergestellt, dass heißt es ist wertvoll und war vor Bürgertumszeiten eine Farbe der Aristokratie. Es war ein Marker für Macht und Männlichkeit, ist dann erst später zu einem bubble-gum weiblich konnotierten Ding geworden. Früher war blau für Frauen, rosa für Jungen. Das hat sich geändert.
B: Bei der Aufnahme des Films – wie hat die Bevölkerung von Tamsweg, Lungau reagiert?
S: Noch wichtig zu erwähnen ist, dass Lungau nicht nur in der Hexenverfolgung eine drastische Rolle gespielt hat, sondern, dass dort nach dem zweiten Weltkrieg Nazigrößen wie Göring versteckt wurden. Es ist in auf vielen Ebenen ein spannendes Drecksheimatding. Die Bevölkerung war irritiert, schon recht abwehrend. Aber es war auch eine Gruppe in einer Bar, die das gut fanden.
B: Noch als Abschluss – hast du eigentlich einen Lieblingsfilm?
S: Ja, natürlich. Switchblade Sisters (1975) oder auch Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965). Da sind schon starke Einflüsse, die mich und Fazo geprägt haben, deswegen hat der Film auch die Ästhetik, die er hat.