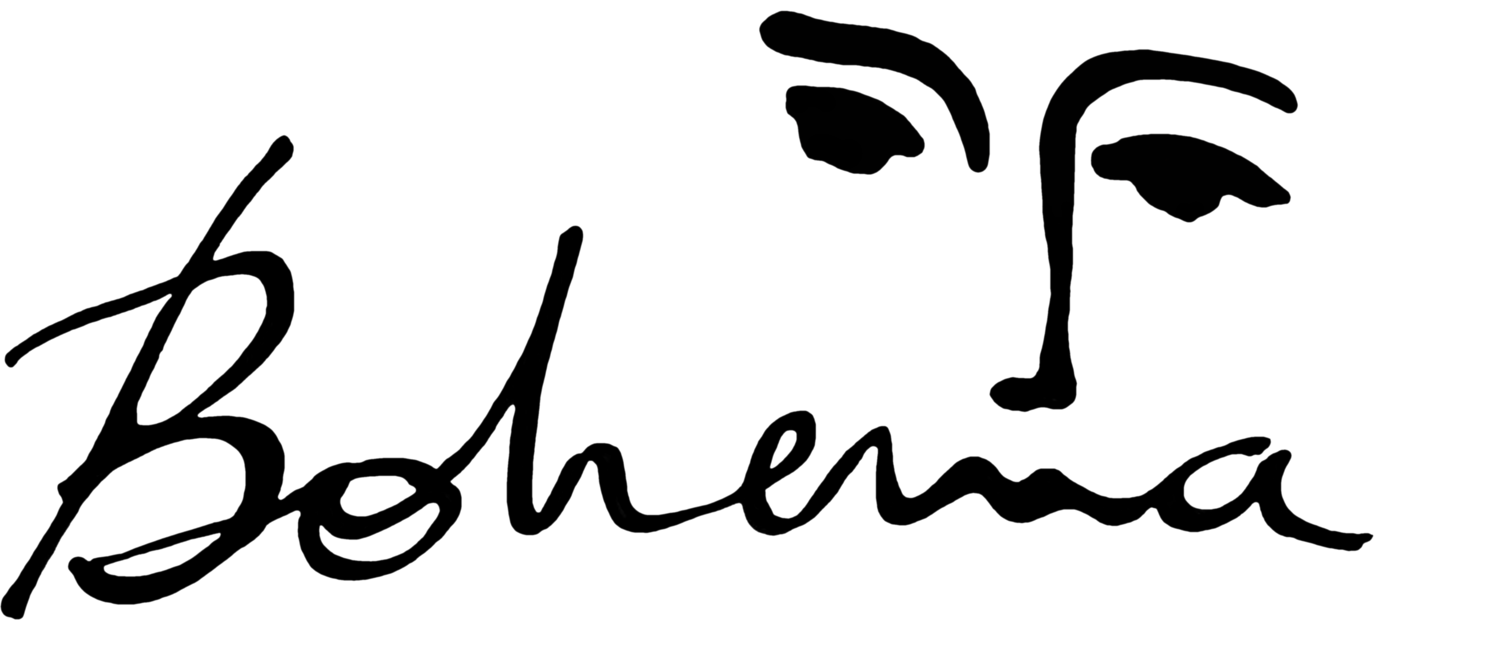Festwochen Logbuch 2025 (2. Teil)
V is for loVe aber auch für Veronica, Vendetta und reView. Verfolge auch dieses Jahr die Highlights von den Festwochen in unserem Logbuch.
90% festivalstimmung / 0% provinziell / 100% miloland
All about Earthquakes /// Nurith Wagner Strauss ©
25. Mai, All about Earthquakes
Zwischen Liebe, Gesellschaftsnormen, noch mehr Liebe, einem kurzen aufflackern einer utopisch solidarischen Gesellschaft der Gegenseitigkeit, bringt die Realität erneut den Tod. Und dabei war die Hoffnung groß: „jetzt wird es anders“, so Josepha am Ende von Rüpings Version von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“. Doch auch hier machen es die immer wieder die vierte Wand durchbrechenden Einwürfe der Ensemblemitglieder deutlich: „Das war ja klar“. Der Erzbischof richtet unbarmherzig wie immer: Josepha und Jeronimo sind verantwortlich für das Erdbeben (so beantwortet sich die Frage der Theodizee). Die Gesellschaft verurteilt die Liebe hier immer noch, aber weniger aufgrund von Klasse, sondern wegen eines Altersunterschieds von ungefähr dreißig Jahren und einer interracial relationship.
All About hooks and Haddaway
Da Rüping hier eine feministisch-moderne Adaption à la Perfektion vollbracht hat, lässt sich eigentlich viel zu viel schwärmen. Ja, es könnte das Aushängestück der Republik der Liebe sein. Intertextuell werden bell hooks „all about love“ und Haddaways „What is love?“ eingewoben. Während einer kurzzeitigen Utopie eines klassenlosen Garten Edens, wird die Bedeutung von Haddaways Song nicht nur zu den Friedensmärschen, den Anschlägen in Rostock-Lichtenhagen und Mölln und zu dem Erstarken der Neonazis und Faschisten eingeordnet, sondern hinterfragt auch, was Liebe ist, die nicht wehtun soll. Hooks ordnet dazu die Liebe neu, sie sei dafür da einander größer zu machen und niemals klein zu halten. Es ginge nicht nur um die Liebe in privater romantischer Beziehung, es ginge um eine Liebe in der Gesellschaft, des Miteinanders, der Solidarität.
Während Haddaways Song immer wieder in Bruchstücken während der Utopie-Sequenz performt wird, spielt sich ein grandioses Bochumer Ensemble (Achtung Kitsch!) in das Herz der Republik der Liebe Wien. Und um es nicht unerwähnt zu lassen: das Bühnenbild von Jonathan Mertz unterstreicht mit regenbogenbunten mächtigen Glasfenstern diese märchenhafte Utopie. Nachdem diese von der Realität eingeholt wurde und der Bischof über die Liebenden gerichtet hat, schickt das Bühnenbild die Zuschauenden mit einem eindrücklichen Bild in die Nacht: die Kirchenbänke werden (versucht) an einem Flaschenzug aufzuhängen, werden immer wieder heruntergelassen, sie sind zu schwer, verhaken sich. Vielleicht so wie die Kirche und das normative Gesellschaftsbild immer wieder in die freie Liebe einhakt und sie beschwert?
Von Lucie Mohme
28. Mai, Di/Strauss Technique
Da ist mir meine fehlende Lesekompetenz mal wieder zum Verhängnis geworden. Das dachte ich mir, als ich das Programmheft studierte und die Wörter „Karaoke-Workshop“, „Heilmethode“ und „anale Magie“ erspähte. Denn als ich mir die Kurzbeschreibung auf der Festwochen-Website durchgelesen und mich entschieden hatte, an Ivo Dimchevs Di/Strauss Technique teilzunehmen, lag mein Fokus anscheinend woanders. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass der Teasertext auf der Website diese Schlagwörter nicht inkludiert. Vielmehr wird die Performance als schweißtreibendes und musikalisches Workout beschrieben. Ich, die nicht mal unter der Dusche singt und jegliche Form des interaktiven Theaters meidet, saß also da – mit meinem komplementären Jutebeutel, gefüllt mit Requisiten – und war nun Teil einer sexuell aufgeladenen, queeren, musikalischen und interaktiven Performance.
Im Laufe der folgenden 1,5 Stunden haben sich tatsächlich fast alle Beschreibungen bewahrheitet. Ivo Dimchev, in Drag, hat mit uns seine Lieder, die auf Melodien von Strauss basieren, einstudiert und Bewegungsabläufe samt Requisiten erarbeitet. Natürlich gab es auch Momente der kollektiven Reflexion über die eigene Sexualität, Identität und Zukunftsvisionen. Di/Strauss steht für die Dekonstruktion von Strauss als elitärer Künstler. Seine Musik wird durch Dimchevs Songtexte subversiv zugänglich gemacht und verqueert. Im Zentrum stehen sexuelle Befreiung, Geilheit und Gleichgültigkeit gegenüber der Meinung anderer.
Ich bin mir nicht sicher, wie heilend diese Erfahrung für mich war – denn bei der Aufgabe fächernd auf dem Schoß einer fremden Person zu sitzen, ist mir mein Sitznachbar mit seinen Händen auf meiner Hüfte unnötig nah gekommen. Dennoch haben sich die Teilnehmer:innen auf das lustige, queere, persönliche und oft sehr absurde Programm eingelassen. Das hat dazu geführt, dass einem die Absurdität der eigenen Handlungen zwar bewusst, aber durch das kollektive Mitmachen der anderen egal war. Trotz meiner Skepsis und grundsätzlichen Aversion gegenüber interaktiven Performances bin ich aus meiner Komfortzone ausgetreten, stolz darauf und habe zumindest eine interessante Geschichte, falls ich jemals nach meiner absurdesten Theater- oder Performance-Erfahrung gefragt werde.
Von Eva Garber
6. Juni, Weiße Witwe
Wir haben das Jahr 2666. Königin Aliah „die Geile“ herrscht über den islamischen Staat Europa und vor allem über die Männer. Ihr Kredo: „Wenn du regieren willst, musst du eine F**** sein!“ Auf ihren Befehl werden junge weiße Männer mit Dubaischokolade in eine Falle gelockt, entführt und nachdem Aliah sie als Sexobjekte benutzt hat, getötet. Eines Tages bietet ein alter weißer Mann aus Floridsdorf (Georg Friedrich) ihr seine sexuellen Dienste an und erzählt ihr die Geschichte der weißen Witwe.
Regisseurin Kurdwin Ayub ist als Filmemacherin bekannt. Zuletzt war ihr Film Mond in den Kinos zu sehen. Für ihr Theaterdebüt Weiße Witwe, das nun im Volkstheater gespielt wird, lässt Ayub sich von der Geschichte von Scheherazade aus Tausendundeine Nacht inspirieren. Sie konfrontiert das Publikum nicht nur mit dem Kischee des alten weißen Mannes sondern auch dem der Assi-Braut, dem des braven Ausländermädchens, dem der Kulturschwuppe und dem Klischee einer Jugend, die vergeblich versucht, alles besser zu machen. Gegen Aliahs matriarchale Monarchie mobilisiert im Lauf des Stücks nicht nur die neue alte Rechte, auch der Generationskonflikt schwelt: Aliahs Tochter Cezaria (Samirah Breuer) rebelliert, weil ihre Mutter mit der Ermordung der Männer doch ein wenig übers emanzipatorische Ziel hinausschießt.
Apollonia Theresa Bitzan ©
Dass der Abend als trashige Komödie zündet, liegt vor allem am überdrehten Spiel des Ensembles: allen voran Rapperin addeN als Aliah „die Geile“. Zudem bringt der Tanzchor SC motion*s in der Choreografie von Camilla Schielin in exotisierenden, sexuell aufgeladenen Kostümen vor den orientalischen Kulissen (Bühnen- und Kostümbild: Nina von Mechow) immer neuen Schwung in die Szenen. Die Stärke von Weiße Witwe besteht weniger in einem tiefergehenden inhaltlichen Beitrag im Diskurs über Religions-, Geschlechter- und Kulturkriege als darin, dem Publikum in scharfer Polemik aufzuzeigen, dass es in stereotype Rollen verstrickt ist und diese mit Glitzer und Popmusik kredenzt auch noch sehr unterhaltsam sein können.
Von Ole Zeitler
6. Juni, Die Seherin
Ein Stück von Milo Rau, inspiriert von Sophokles' Philoktet. Also welcher Mythos wird hier nun nacherzählt, Philoktet oder Kassandra? Der Titel sorgte bei mir zugegebenermaßen für Verwirrung. Muss man das gelesen haben? Und was ist die Verbindung zum Irak? Kassandra hatte ich glücklicherweise bereits gelesen (nur gelegentliche Verwechslungsgefahr mit Medea, weil Wolf), im Philoktet komme ich bis Seite 23: Odysseus als Intrigant, Neoptolemos, der sich zunächst zweifelnd Odysseus' Willen und seiner Pflicht beugt, Philoktet als Zurückgelassener und Ausgestoßener, auf Empathie und Rettung hoffend.
Und dann sitze ich im Odeon, zunächst Platz siebeneinhalb, dann Platz acht, weil doch noch jemand kommt, Körperkontakt zu beiden Seiten, das will man doch im Theater: berührt werden. Und es gelingt, von der ersten Sekunde an wird man hineingesogen, durch die Barockmusik (Bachs Agnus Dei setzt den Ton und das Thema) und durch die knirschenden Schritte der Schauspielerin Ursina Lardi auf dem „irakischen“ Sand, den sie auf die Bühne gegeben haben.
Die gekonnte Mischung aus Dokumentation und Fiktion, der (endlich mal) ganz und gar nicht überflüssige Einsatz der Kinoleinwand im Theater – 2 Erzählebenen werden geschaffen, klare Trennung sowohl aus auch Interaktionen zwischen diesen Ebenen gelingen!; hier wird ein Raum für das Publikum geschaffen, welches den ganzen Abend über fokussiert dabei bleibt. Schließlich sind es nur knapp anderthalb Stunden, in denen Milo Rau uns Zuschauende in den Irak reisen lässt, wir ihn aber auch von seiner privaten Seite kennenzulernen. Denn was Ursina Lardi uns in ihrer Rolle als Kriegsfotografin erzählt, ist ein Verworrensein von autobiographischen Details aus ihrem und Milos Leben, aber eben auch den zahlreichen Erfahrungen von Kriegsfotograf*innen, mit welchen die beiden auf deren Recherchereisen gesprochen haben. Dieses Verworrensein, das Spiel mit Fiktion und Dokumentation, der Zynismus mit dem über brutalste Gewalt gesprochen wird bis hin zur Darstellung krasser Trauer, Verzweiflung und Verletzlichkeit in Lardis Spiel und Azad Hassans authentischem Bericht über seine Verstümmelung durch den IS sind Spannungsfelder, die dieses Stück ausmachen und uns auf den Stuhlkanten sitzen lassen.
Ein Mythos nacherzählt wurde hier selbstverständlich nicht, denn es ist Milo Rau at its best: es wird ein Bogen geschlagen von realen Menschen, hier mit uns im Odeon-Theater, Menschen aus Fleisch und Blut, bis hin zur Antike, wenn man will auch bis an die Anfänge der Meinschheitsgeschichte und bis in die Zukunft: was Menschlichkeit bedeutet, was es bedeutet Leid zu erfahren, Ungerechtigkeit zu erfahren, sich ausgegrenzt zu fühlen – so wie Philoktet und Kassandra – und wie ein Sehen und ein Gesehen-werden vielleicht etwas bewirken kann.
von Anna Perl
11. Juni, Gaviota
Theater Nestroy Hamakom. 4pm on a Wednesday. I imagine a seagull circling the room. The air is stuffy; smoke engulfs a table. On this modest wooden table five women sit in front of black microphones, with unmoving faces and stern eyes. Two are facing away from me. When they speak, I can’t see their facial expressions but can only observe their body movements from behind.
The play is about to start. Wine glasses, red stains, bags of crisps and scattered pieces of paper lie on the table as if there are caught in the static, frozen hand of time. The music pulls the listener into another dimension. A language of a special kind. The Spanish words grip, pull, tear on heart and soul.
Gaviota /// Francisco Castro Pizzo ©
The play has started. Are we all not afraid to be alone at the end, Chekhov’s ghost whispers into my ear. He is sitting next to me, taking up the vacant spot, wearing this strange suit and his characteristic pince-nez that make him look like a real intellectual. The metaphoric seagull lands on this shoulder. He doesn’t seem to mind at all. The women begin to speak, as an intermediary Spanish speaker I alternate between listening and reading the translation. Sometimes I feel watched. Eyes meeting eyes.
Suddenly, someone shoots the seagull. A loud bang and screaming. Unrequited Love, unheard stories, loss, tragedy and unfulfilled dreams flow out of its body evaporating into small particles that dance around the audience as if whispering a mysterious, long forgotten secret.
Von Maja Jakovac
12. Juni, Goodbye, Lindita
Museumsquartier. Hall G. 20:30 on a Thursday. I imagine the corpse of a women sitting next to me. It’s silent, eerily silent. She doesn’t speak, no one does. It’s obvious that she has left the land of the living. She is dead. What does that mean?
Some things cannot be expressed using words. The Unspeakable always finds a way to creep into our everyday life. The silence is thick, occasionally broken by distorted voices coming from the TV, whispers, gentle whistling and the scraping of moving chairs. Lights, orange, white, blue, red metamorphose and turn the scene into a moving picture.
There are hands in the walls. Reaching out of holes. There are naked bodies, maybe because grief leaves us stripped and bare. There is an obscure vulnerability to it, a soul-crushing helplessness. Sobs echo through the room. Bodies lean against walls, hide under the blankets, lie on the floor and eyes look out of windows.
As I turn towards the woman, I flinch. She is wearing a golden mask. A part of her lives on eternally.
Von Maja Jakovac
18. Juni, La Gouineraie – Der Lesbengarten
Sandra Calderan und Rébecca Chaillon kreieren einen Garten, in dem sich queere Konzeptionen von Familie, Leben und Liebe fernab von heterosexuellen Zwängen entfalten können. Dabei greifen sie gekonnt Stereotypen, gleichsam Mythen des lesbischen Lebens auf: Calderan, die immer wieder ein Karohemd auszieht, nur um darunter ein neues zu enthüllen oder dass sie wirkt wie die Alleskönner-Lesbe während sie im Garten herumwerkelt und ein Bücherregal baut. Zu Beginn holt sie ihre Partnerin Chaillon mit dem Spielzeugtraktor ab und baut auf der Bühne Bauklotzhäuser und Türme.
Die Performance ist in Zügen autobiographisch der Performerinnen selbst, wird komödiantisch eingeleitet und dem Publikum als Reality-Show präsentiert. Die Kombination aus Spielzeugtraktor, einem humorvoll-ironischen Spiel und einer Rébecca Chaillon, die wirklich alles mit einer kitschig-hässlichen grau-violetten Rosentapete zutapeziert, wirkt vorerst ungebrochen leicht und unterhaltsam. Doch das utopische Experiment, in dem die Dyke-Seeds gepflanzt und Lover, Verflossene und Partner:innen in einem gemeinsamen Haus wohnen, ist in Realität weniger romantisch.
Marikel Lahana ©
Währen Chaillon mittlerweile auch ihre eigene nackte Haut zutapeziert hat und auf der Malerleiter mit Kuhglocke zwischen den Beinen steht, bricht die Leichtigkeit der utopischen Vision. In erzählhaften Ansprache klagt sie an, womit queere Personen in einer Welt, die Körperlichkeiten abseits der Norm kritisiert, konfrontiert sind. Zuletzt werden die Zuschauenden miteinbezogen: Könnten sie sich dieses Zusammenleben vorstellen? Der wortwörtliche Höhepunkt am Ende: Die Zunge eines Stiers, der die Zunge beim lesbischen Sex darstellt, geführt von Calderan am Körper von Chaillon. Abstoßend? Ja, weil hier ein Leichenteil verwendet wird. Im übertragenen Sinne ist es jedoch wirkungsvoll und kritisiert das Bild, dass die Gesellschaft über lesbischen Sex hat.
Von Lucie Mohme