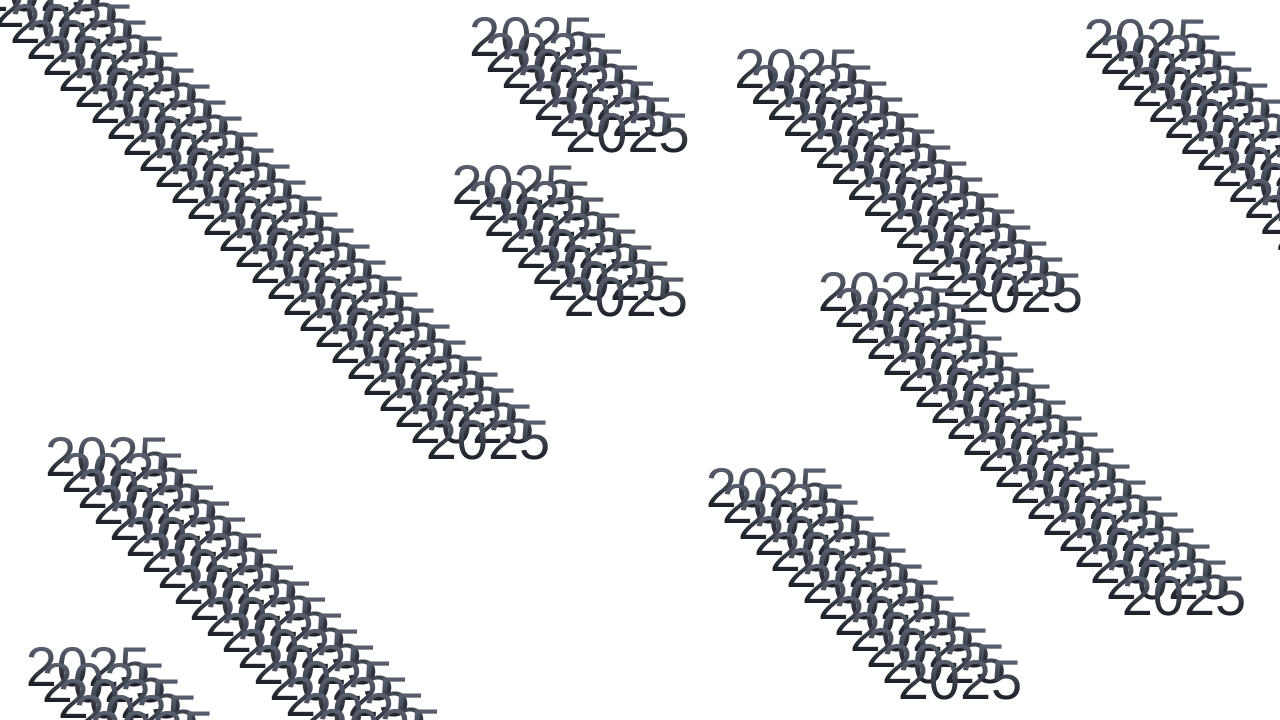Jahreshighlights der Redaktion
Viel passiert, viel vergessen. Nichtsdestotzrotz: einige Gedanken zu dem, was hängengeblieben ist. Guten Rutsch!
Rosalías LUX und die Revolte gegen Monokultur
Ich bin kein Latin-Pop-Girlie und hab mit Reggaeton nur dann zu tun, wenn ich in Portugal Urlaub mache oder mich die obligatorischen zwei Mal im Jahr in meine Duolingo-Spanisch-Mission stürze. Als ich im Rahmen eines Jobs zum Pre-Listening-Event von Rosalías viertem Album, LUX, eingeladen wurde, war ich also erst mal recht ratlos, was ich denn dort solle – mein Duolingo-Strike war schon seit Monaten gebrochen und mein musikalischer Hyperfokus lag derzeit bei Kendrick Lamar. Doch gegen Bezahlung für zwei Stunden in einem alten Kino sitzen und in Dolby-Surround Musik hören, lässt man sich nicht entgehen. Ich machte es mir also erwartungslos im roten Sitz gemütlich und plante, einen ausgiebigen Nap zu machen, als die Anmoderation des Albums meine Neugier erregte. Die Damen von Sony sprachen von einem Konzeptalbum, von einer schwer zu greifenden Intensität und davon, dass sie selbst nicht ganz wussten, wie man ein Album wie LUX überhaupt angemessen beschreiben sollte. Es würde um Gott gehen, um Liebe und irgendwie auch um die weibliche Befreiung. “Es ist Poesie, die man so zuvor noch nie gehört hat”, hieß es. Intriguing. Ich entschied mich dazu, die Augen geöffnet zu halten, als der Saal verdunkelte, die ersten Töne spielten und die Lyrics in deutscher Übersetzung auf der Leinwand erstrahlten.
Tja, und dann erlebte ich 49 Minuten, die mich komplett vom roten Samtsessel rissen, und es seither noch immer tun. Es ist absolut gerechtfertigt, dass etwa “Berghain” als erster Single-Release des Albums binnen Sekunden international vollkommen durch die Decke ging – die orchestrale Komposition, die emotionale Wucht, die die 33-Jährige mit sonderbarer Leichtigkeit vermittelt und die symbolische Bildgewalt und Thematik sind nur ein paar von meiner Meinung nach 300 Aspekten, die den Song besonders machen. Das ganze Album entspricht dieser Intensität; während meiner Zeit im Kinosaal war ich mir sicher, dass ich derartiges zuvor wirklich noch nie gehört hatte. Gio Santiago von Pitchfork beschreibt die Wirkung von LUX recht treffend: “Es ist keine Dopamin-Maschine, aber es belohnt Zuhörer*innen, die sich mehr von Pop-Artists wünschen: mehr Gefühl, mehr Risiko.”
Rosaliá verbindet nicht nur verschiedene Musikrichtungen wie etwa Klassik, Samba und Pop – sie kreiert etwas völlig Neues in einer Musiklandschaft, die nicht mehr dazu in der Lage scheint, tatsächlich Originales hervorzubringen. LUX ist riskant, es ist frisch und gleicht keineswegs dem, was die kommerzielle Popmaschine des Westens sonst so auf den Markt bringt. Der Kulturtheoretiker Mark Fisher sprach bereits in den frühen 2000ern von der Stagnation kultureller Produktion, er beschrieb den Beginn einer Eiszeit, in der Musiker*innen zunehmend altes reproduzieren und sich die Nostalgie zu eigen machen, statt tatsächlich zu kreieren. Er argumentierte, dass sich Musik langsamer weiterentwickelt und prognostizierte eine monokulturelle Entwicklung. Schwindende Ressourcen für öffentliche Musikproduktionen und Konzerte, die Konzentration des Musikgeschäfts in den Händen weniger Akteure, die auf Kosten der Künstler*innen das gesamte Geld abschöpfen (Grüße an Spotify), sowie die allgemeine Rezeptionserschöpfung dank technologischer Überstimulation geben Grund zur Annahme, dass wir uns schon länger aktiv in einer Phase der kultureller Stagnation befinden. Eine, in der alles bereits existiert, und immer weniger Artists die Chance oder Vision haben, wirklich mal was zu kreieren, um die Ecke zu denken und tatsächlich Kunst zu erschaffen.
Vor diesem Hintergrund, verstärkt durch die Flut an von KI-Technologien produzierter Musik, tritt Rosalía als Künstlerin sondergleichen hervor. Nicht nur scheint sie ihre eigene Musik mit jedem neuen Album ein bisschen neu zu erfinden, sie bietet einer stagnierenden Musikkultur einen Lichtblick, ein Aufatmen all jener, die sich in einer sich immer zu wiederholen scheinenden Kultur nach Aufregung und neuen Impulsen sehnen. Dass Rosalía mit LUX in den Mainstream gelangt ist, tut ihrer Originalität in meinen Augen keinen Abbruch – viel eher unterstreicht das die allgemeine Sehnsucht nach risikobereiter Kunst, die die Grenzen zu sprengen versucht, statt sie lediglich dauerhaft neu zu verschieben.
Theaterhighlight 2025: „Fräulein Else“ im Volkstheater
„Fräulein Else“ im Volkstheater ist kein Geheimtipp mehr. Vor wenigen Tagen kürte Der Falter den Soloabend nach Arthur Schnitzlers gleichnamiger Novelle zum Theaterhighlight 2025. Als beste Schauspielerin wurde Julia Riedler vom Magazin Theater heute sowie mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet. Leonie Böhm erhielt den Nestroy für die beste Regie. Keine andere Produktion des Wiener Theaterjahres wurde mit so vielen Preisen gefeiert. Und ja: Der Hype ist mehr als berechtigt.
Da Elses Vater in finanzieller Not ist, soll sie den reichen Dorsday um Geld bitten. Dorsday ist zur „Hilfe“ bereit – jedoch nur unter der Bedingung, Else 15 Minuten nackt zu sehen. Julia Riedler begibt sich als Else in einen direkten Dialog mit dem Publikum und improvisiert ausgehend von dessen Antworten schlagfertig. So lernt man zunehmend die anderen Menschen im Saal kennen. Das Publikum wird zu Mitwissenden eines sexualisierten Machtmissbrauchs, zu potenziellen Unterstützer*innen von Elses Versuchen feministischer Selbstbestimmung, aber im Theater auch unweigerlich zu Voyeur*innen. Wie Dorsday hat das Publikum gezahlt, um Else zu sehen. So entsteht ein Gefühl für die eigene Ambivalenz in toxischen Machtsystemen.
„Fräulein Else“ bringt Menschen zusammen, ohne dass ihnen auf totalitäre Weise vorgegeben wird, was sie zu fühlen und zu sagen haben. Das Theater wird in seinen emanzipatorischen Potenzialen ernst genommen, ohne seine Verstrickung in Machtverhältnisse zu kaschieren. Diese werden vielmehr offen gelegt und kritisch befragt. Schnitzlers hundert Jahre altem Text wird so begegnet, dass seine Aktualität schmerzt, die Inszenierung aber dennoch nicht in Hoffnungslosigkeit mündet. Die Potenziale des Theaters werden in einer Konsequenz und Präzision genutzt, wie man es nur selten erlebt. Die nächsten Vorstellungen finden im Januar statt. Lasst es euch nicht entgehen!
Zwischen Teheran und Winnipeg: Universal Language (CAN, 2024), Matthew Rankin
In einer Welt zwischen Teheran und Winnipeg, in der Truthähne im eisigen Schnee stolzieren, Parkplätze als historische Stätten gelten und Tränen in Gläsern gesammelt werden - genau dort lässt der Film Universal Language (CAN, 2024) des kanadischen Regisseurs Matthew Rankins seine Zuschauenden aufatmen. Denn während dieses Jahr außenpolitisch eine Bedrohung nach der anderen folgte, Rechtsruck und Faschismus zunehmend auch innen in die Enge trieben, war Universal Language (CAN, 2024) der Traum von transnationaler Gemeinschaft, den einem die politische Realität verweigerte.
Der Film, der im Januar 2025 in den österreichischen Kinos erschien, erzählt von Migration, Zugehörigkeit und kulturellen Zwischenräumen, ohne aber explizit zu benennen. Es sprechen vor allem seine Bilder und vermitteln damit eins: das Gefühl von bedingungsloser Zusammengehörigkeit. Der Film von Rankins ist poetisch und intim, manchmal auch skurril und absurd, aber es ist seine Märchenhaftigkeit, die mitnimmt. Nicht ohne Grund bezeichnet ihn Michael Grünwald als Welt in einer Schneekugel, die ihre Bewohnenden, Sprachen und Orte einmal gründlich durchschüttelt: Zwischen Farsi und Französisch, Iran und Kanada, brutalistischer Tristesse und surrealistischem Traum, verweben sich die Geschichten dreier Hauptfiguren in einem transnationalen Raum.
Universal Language spendet Hoffnung und zeigt, worauf es bei wahrer Verbundenheit ankommt: Sehen und gesehen werden, und das mit viel Vertrauen und bis ins Detail.
Männer, Musik, Maskerade
Es mag ein wenig nach Rolling Stone Magazin klingen (bestes Album des Jahres dort, im Kreise der Ü60er: die neue Scheibe von Pulp!), einen 2025er-Text so zu beginnen, aber: zu Weihnachten kippe ich verlässlich und jährlich in eine Bob-Dylan-Phase. Vermutlich, weil ich die weihnachtliche Einkehr mit Dylan verbinde, dessen auf dem Cover einer Biografie im elterlichen Stahregal thronendes Gesicht eines der ersten ist, an das ich mich erinnern kann. Auf meinem Lieblings-Dylan-Song singt der Mann lakonisch: „Idiot wind blowing every time you move your teeth. You're an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe“.
Keine Sorge, hier folgt nun keine Ausformulierung dazu, warum das nun der Song der Stunde sei, was das mit Donald Trump, Jerome Boateng oder anderen Schlimm-schlimm-Männern der Gegenwart zu tun hat, das darf und kann jede*r aufs eigene Leben (oder sich selbst) übertragen – bekanntlichermaßen das Schöne an der Kunst, hach.
Überrascht hat mich dieses Jahr, dass das Dylan’sche Rezept immer noch zu ziehen scheint.
Über Cameron Winter, der fünf Jahre jünger als ich ist und schon in der Carnegie Hall aufgetreten ist, wurden im Zuge dieses Auftritts (Dylan hat da auch total jung gespielt!) allerhand andere Parallelen gezogen – markante Nase, ungewaschene Haare und eine Stimme über die der Ottonormalhörer gern sagt: „der kann doch gar nicht singen“. Ob das sinnvoll ist oder nicht ist eine recht langweilige Frage, der Vergleich naheliegend.
Dass Scharen junger Leute inkl. mir darauf – und auf Winters Band Geese – abfahren, ist aber doch erstaunlich. Gute Musik ist das für mich zweifelsohne, ziemlich sogar, die hätte ziemlich genau so aber auch gut vor vierzig Jahren erscheinen können und niemand hätte sich gewundert. Dass Winter nun zum ersten Rockstar der Gen Z stilisiert wird wirkt aber doch etwas schal. Was das jetzt von der Britpop-Welle, die retrospektiv recht einstimmig als konservative Rückkehr zu ebendiesem breitbeinigen Rockstar-Personenkult abgeschasst wird, unterscheidet?
Vielleicht, dass mit dem Hype um Geese parallel eine in sozialen Medien stattfindende Ironisierungs-Welle grassiert, in welcher die (wohl ausschließlich männlichen) Fans der Band als schnurrbarttragende „performative Males“ kategorisiert werden, die sowas eigentlich nur hören, um sich für etwas besseres zu halten und besonders zu wirken.
Wer mit einer Geese-Platte unterm Arm im Café setzt, macht sich folgerichtig ebenso verdächtig, ein „Fuckboy im Schafspelz“ zu sein, wie die taz im September titelte, wie Männer, die Bücher in der Bahn lesen. Insbesondere wer bell hooks oder Judith Butler lesen möchte, tut das an liebsten im eigenen Kämmerlein, wenngleich gerade Butlers Performativitätsbegriff ein Stein im Schuh des „performative Male“-Konzepts ist – damit könnte man dem Ganzen am Ende gar etwas Positives abgewinnen, aber pssst.
Zurück zu Idiot Wind: „Typen, die in der Öffentlichkeit lesen, waren schon immer meine Feinde, weil sie keine einzige Frage dazu beantworten können“, spricht eine Expertin in der taz. Gott sei dank gibt es auch in Deutschland bald wieder die Wehrpflicht, um junge Männer von solchen Schnapsideen abzubringen!
Ein (irisches) Filmjahr
Die für mich eindrücklichsten Filme dieses Jahr, hatten meist einen irisch-anglophonenAnstrich: sei es durch den Cast, Ort oder auch die thematische Nähe. Atmosphärisch undcharakteristisch sind sie szenisch düster, melancholisch und doch mit hoffnungsvollerResolution. Sie haben mit ihrer einzigartigen Verarbeitung der Themen Coming-of-Age, (Generationen)-Trauma und Heilung einen Eindruck bei mir hinterlassen. The Outrun (Nora Fingscheidt) spielt auf der dramatischen Filmkulisse der schottischen Orkney Islands. Saoirse Ronans Performance prägt den Film mit ihrer Nuance von Ablehnung bis zu Akzeptanz aufihrer Reise aus der Alkoholabhängigkeit heraus. Die irische Schauspielerin erzählt eine Geschichte über Recovery, das Inselleben auf den stürmischen Orkneys und Aufarbeitung von Trauma. In der Isolation auf dieser schottischen Insel wird die Protagonistin intensiver auf sich selbst zurückgeworfen und ist beispielsweise mit der Realität, Weihnachten allein in einer vom Sturm umgebenen Hütte zu verbringen, konfrontiert.
Bird (Andrea Arnold) zeichnet die Kombination aus Magical-Realism und Coming of Age Genre aus. Nykiya Adams und Franz Rogowski erzählen eine Geschichte von dem Leben einer zerbrechenden Familie in einem besetzten Haus in einer Hafenstadt in der Nähe zu London. Neben Baileys (Adams) Identitätssuche und Vigilantismus einer organisierten Gruppe ihres Bruders fokussiert sich der Film vor allem auf die Freundschaft zwischen der zwölfjährigenBailey und dem nomadisch lebenden Bird (Rogowski). Zusammen navigieren sie die Lebensrealität ohne Halt und Sicherheit. Der Magical-Realism wird durch die Transformation von Bird in einen echten Vogel inszeniert. Die Darstellung schwankt dadurch zwischen Einbidlung und Realität und kreiert eine hoffnungsvolle melancholische Atmosphäre.
Barry Kheogan, der in „Bird“ den jungen arbeitslosen Vater von Bailey verkörpert, spielt in dem irischen Film Bring them Down (Christopher Andrews) den Sohn eines Schafzüchters. Im jahrelangen Konflikt zwischen den Schafbauern, werden auf brutalste Weise Emotionen verarbeitet. Dabei reicht die Gewalt von Schafsmord bis zu Menschenmord im Kampf mit dem Geneartionentrauma. Der Film zeigt brutal und ungefiltert den Schmerz unausgesprochener Gefühle. Wer sich auf Heilung, Magical Realism, aber vor allem die außergewöhnlichen dramatischen Spielorte und Inszenierungen der drei irisch-anglophonen Filme einlassen möchte, empfehle ich meine Highlights 2025.
The Art of Loving
Ach ja, ich würde so gerne zu den Menschen gehören, die einen einzigartigen Musikgeschmack haben. Ich gehöre nicht dazu - auch dieses Jahr nicht, wie mein Spotify Wrapped mir mal wieder vor Augen geführt hat. Aber heuer könnte es mir nicht egaler sein.
Immer wenn ich versucht habe, meinen Geschmack einem Genre zuzuordnen, fiel es mir irgendwie schwer. Spätestens als ich dann über Erykah Badu stolperte, wurde mir klar: Ich bin wohl durch und durch ein Neo-Soul-Girlie. Meine Begeisterung für Olivia Dean bestätigt dies mal wieder, denn beim Hören ihres Albums dachte ich nur: Endlich mal wieder etwas, das ich am Stück hören kann!
Mit The Art of Loving hat Dean ein Album gezaubert, das sich ganz der Liebe widmet. Doch statt überbordender Dramatik setzt sie auf sanfte Melodien. Musikalisch lässt sich ihr Stil in die Nähe von Neo-Soul, Jazz und Pop rücken: warme Klänge, organische Grooves und ihre klare Stimme. Akustikgitarre, begleitet von Violinen und sanften Klaviertönen - das Album bleibt größtenteils recht minimalistisch instrumentalisiert. Deans Stimme reicht sowieso. Zwölf Songs über die Suche nach romantischer und platonischer Liebe. Wie man sich zwischen Verletzlichkeit und Sehnsucht selbst findet und lieben lernt. Das Album fühlt sich irgendwie an wie eine sanfte Umarmung - selbst dann, wenn sie über endende Umarmungen singt: “You’re the hug that had to end / Though I’ve tried to hold on.“
Genau das macht Dean für mich so besonders: Ihre Fähigkeit, Herzschmerz mit Wärme zu verbinden. Alles ist irgendwie weich und tröstend. Obwohl sie über Abschiede, Rückfälle zu alten Liebschaften und gebrochene Herzen singt, schafft sie es, mit diesem Album Geborgenheit zu vermitteln. Dabei betont sie immer wieder, wie wichtig Wertschätzung ist: Wir müssen uns um unsere Beziehungen kümmern, Arbeit hineinstecken und freundlich miteinander umgehen. Dieser Gedanke zieht sich nicht nur durch den zweiten Song des Albums Nice to Each Other - auch im Gespräch mit Apple Music spricht Dean darüber, wie wichtig es ist, Raum für andere Künstler*innen zu lassen. Es sei Platz für den Erfolg von allen da, sagt sie - und wenn Kolleginnen wie RAYE oder Lola Young größere Erfolge feiern, freue sie sich von Herzen. Diese wertschätzende Haltung hört man ihrem Album an.
The Art of Loving ist für mich deshalb nicht nur ein Album über Liebe. Es ist eine Einladung, sich der eigenen Gefühlswelt zu stellen, Beziehungen zu reflektieren und vielleicht mit etwas mehr Freundlichkeit und Wohlwollen anderen Gegenüber ins neue Jahr zu starten. Vorsatz für 2026? Etwas mehr wie Olivia Dean werden.
House of Houmsi
Mit ihrer neuen One-Woman-Show beweist Salwa Houmsi, dass es keine große Produktion braucht, um souverän zu podcasten. House of Houmsi ist ein Trend-, Laber- und Hobbypodcast mit ganz persönlichem Anstrich. Unter den gefühlt tausend Popkulturoutlets ist es erfrischend nicht dieselben drei Leute über dieselben fünf Acts sprechen zu hören, sondern eine Person, die genau zwischen Gen Z und Millennials steht und dadurch einen Sweet Spot trifft. Salwa Houmsi ist einerseits gut informiert und lässt sich andererseits voll auf den neuesten Tea ein. Ist es peinlich einen Boyfriend zu haben? Wieso hat Heidi Klum einen Bambi für Diversität bekommen? Es geht um quasi alles, das irgendwie komplett unwichtig ist, aber doch einen Diskurs wert, wenn man gerade nicht die Energie hat, um sich mit den neuesten Gefechten in der Ukraine oder den konstant wahnhaften Ereignissen im Weißen Haus, auseinanderzusetzen. Man kennt Salwa Houmsi mittlerweile, sie moderiert 13 Fragen und Aspekte für die deutschen Öffentlich-Rechtlichen, jahrelang hört man sie bei Radio Fritzoder sieht sie in Interviews mit den Größen des deutschen Hip-Hops und der internationalen Popwelt (bspw. Lorde und Billie Eilish). In meiner sehr persönlichen Welt nimmt dieser Podcast einen Platz ein, der schon länger leer geblieben ist. Eine junge hippe Person spricht über die Themen, die Gen Z bewegen, ist dabei informiert und reflektiert, außerdem so sympathisch und begeistert von den Diskursen, dass es mir immer wieder aufzeigt, wieso mich Popkultur und Trends nie ganz loslassen, egal, ob ich ihnen selbst folge oder nicht. Trenddiskurse biegen oft in eine abwertende Richtung ab, vor allem wenn diese überintellektualisiert werden, deshalb ist es so schön zu sehen, wie Salwa Houmsi die Popkulturwelt ernst nimmt und trotzdem nicht die Absurdität mancher Diskussionen vergisst.
Alles ist Brotherhood
Die brasilianische Theatermacherin und Performerin Carolina Bianchi ist mit ihrem Kollektiv Cara de Cavalo (übersetzt: „Pferdegesicht") und dem zweiten Teil The Brotherhood ihrer Trilogie Cadela Força („Schlampenstärke") im Juni erneut in Wien bei den Festwochen zu sehen gewesen. Letztes Jahr mit ihrem Stück Die Braut und Goodnight Cinderella noch im Museums Quartier, stellte sie heuer dem ausverkauftem Volkstheater mit großer Bühne ihr bedingungslos radikales Theater vor.
Im letztem Jahr überließ sie sich mit Einnahme von K.O.-Tropfen in Bewusstlosigkeit ihrem Ensemble, diesjährig war sie wach und ging vom Intimen, von den individuellen Erzählungen ins Große und Ganze: Das Theater in seiner Geschichte als Raum der Macht und Ort der Gewalttätigkeit. Als Geist geht Bianchi durch die Zeit, erzählt, stellt Zusammenhänge her und hinterfragt. Auf die Unsicherheit, wohin oder was zu tun ist mit einem vergewaltigten Körper, reagiert sie mit einer Rückkehr zum Körper und verwendet Vergewaltigung als Hoffnung gegen Wut. Was klar wird, dass es hier eben nicht um ein Trauma geht, sondern um das allgemeine Problem von Trauma.
Bianchis artistische Logik funktioniert in der Ausformulierung über Komplexität bzw. Intellekt. In knapp vier Stunden wird verdichtet, verdichtet und nichts versteckt. Bianchi will dem Gefühl der Gewalt eine Form geben. Vor allem über Text, der einerseits von ihr stammt, andererseits über Dante, Sarah Kane etc. geht, versucht sie für das Unbeschreibliche Worte zu finden. Nächstes Jahr führt sie fort, wird mit dem dritten Teil der Trilogie wiederkehren und da aufhören, wo sie angefangen hat: im Fegefeuer.
Wer ihre bisherigen Arbeiten verpasst hat, wird sie sich im kommenden Jubiläumsjahr bei den Wiener Festwochen nochmal anschauen können. Bianchis Vorhaben ist es, dort alle drei Teile hintereinander als Gesamtkunstwerk zu spielen.