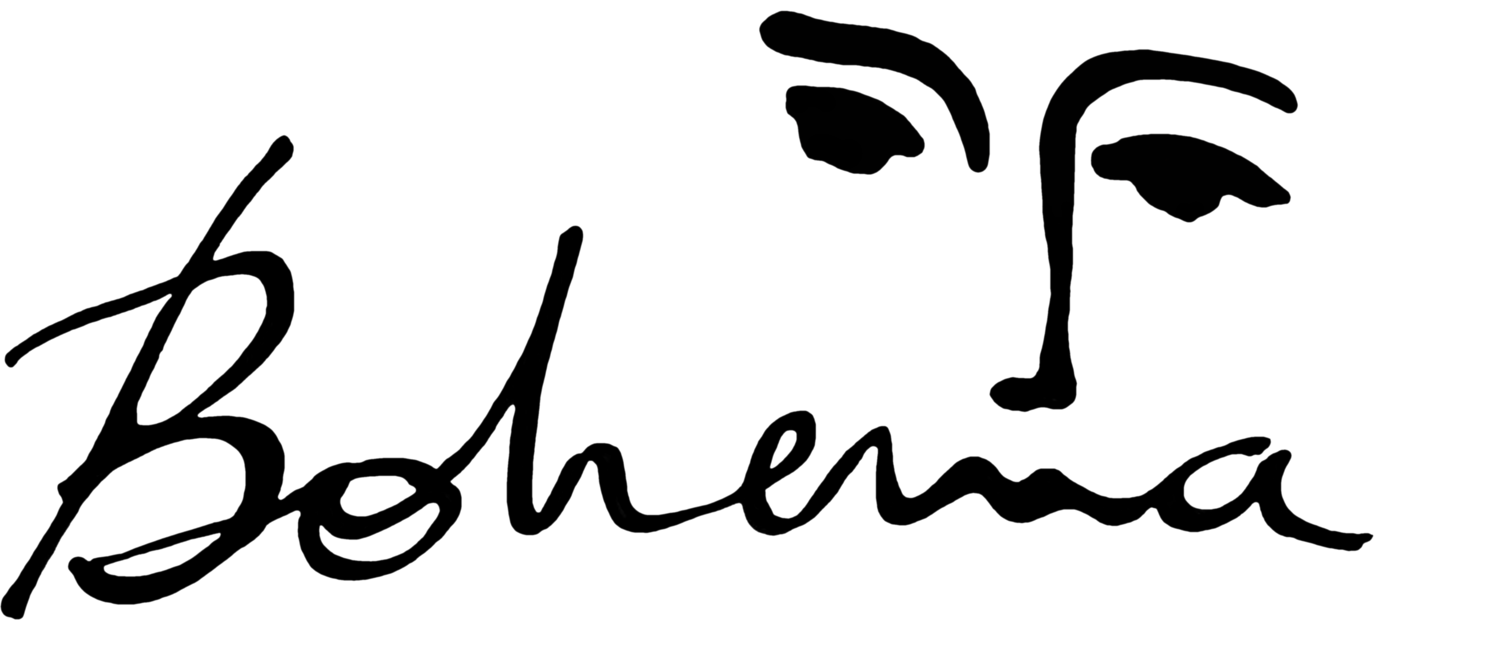Zartmann: „Ich schau mich um, nach allem, was ich süß find“
Tanzt Gen Z gerade auf sexistischen Deutschpop? Statt aufzutauen, friert Zartmann in seiner neuen EP die Liebe völlig ein und trifft dabei, gewollt oder ungewollt den Punkt, warum die Gen Z kein Commitment kann.
Gota obey Zartmann… © Luis Frederik | DIFFUS Magazin
Platz eins in den deutschen Charts, jetzt ein neues Album: Zartmann ist gerade ein Liebling der deutschen Popszene. Stilistisch bewegt er sich wie gewohnt zwischen soften Sounds und liebesverirrten Lyrics, es sind acht Tracks und 18 Minuten Herzschmerz. Im ersten Song wann schreib ich einen Song über dich wird gleich das Thema des Albums angekündigt: untermalt mit einem Streichquartett singt Zartmann (wie er wirklich heißt, hält er geheim): „Die nächsten sind für dich“.
Ein volles Orchester und elektronische Beats verstärken das Pathos der Musik, während Zartmann extra zart (nomen est omen) ins Micro nuschelt. Über den Stil des Gesangs kann gestritten werden, uns geht es hier aber um seine Texte. Neben den Sehnsüchten und Ängsten, die mit der Liebe kommen, findet sich in ihnen nämlich auch das seltsame Verhältnis, das gerade junge Männer zu ihren Emotionen haben, sowie auch ihre Anforderungen an romantische Beziehungen. Das Scheitern der Beziehung kündigt sich schon in den ersten Songs an, denn anstatt sich auf die andere Person einzulassen, wird immer offensichtlicher, mit welchen Problemen das Ich in seinem Umgang, mit dem Du zu kämpfen hat.
Bindungsängste und tiefgefrorene Gefühle
tau mich auf, der zweite Titel des Albums, scheint dabei ein Prototyp zu sein für die Schwierigkeiten, die vor allem heterosexuelle Männer haben, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Anstatt auch mit anderen darüber zu sprechen, will das lyrische Ich in einer Beziehung emotional eben „aufgetaut“ werden. Jede Verbindung zur eigenen Gefühlswelt scheint da zu fehlen. Irgendwo zwischen Partys und Drogen (oder wie Zartmann singt: dem Wesentlichen) und einem schnellen Beat stellt das Ich fest: „wie schön du bist, Gott, ich könnt falln für dich, zu lang nichts gefühlt, ich weiß nicht mehr, was Liebe ist“. Aber: wenn die andere Person tanzt, taut er auf. Kommunikation scheint nur an der entsprechenden anderen Person hängenzubleiben und selbst sprechen ist ohne die ersten Schritte des Dus nicht möglich.
Die zwei darauffolgenden Stücke Schönhauser (feat. Gustav) und Schönhauser Skit machen das Problem noch offensichtlicher. Das Ich stellt selbst fest, dass Reden nicht hilft und versteht auch das Du an vielen Stellen nicht. Wichtiger als Kommunikation scheinen hier wieder die Partys und die Drogen zu sein. Die eigene Orientierungslosigkeit schlägt sich auch in der Beziehung wieder. Das Problem der Situation wird eigentlich geklärt:
„wieso soll ich fühln wenn es wehtut“
In für immer? Kommt dann die Vorstellung, die das Ich von einer optimalen Beziehung hat. Direkt zu Beginn die Line „Ich hab‘ das erste Mal ein bisschen Geld für uns […] lass uns Heiraten“. Die Emanzipation hat hier wohl noch etwas Arbeit zu leisten. Und eine Frau hat vor allem eins zu sein: „Ich schau mich um, nach allem, was ich süß find“, wenn das nicht mal eine Basis ist, auf die sich eine Beziehung aufbauen lässt (Achtung, Ironie). Die Frau ist süß, der Mann hat Geld. Gleichzeitig lässt sich in dem musikalisch irgendwie Tropen-All-inclusive-Urlaub anmutenden Track auch eine gewisse Unerreichbarkeit des Ichs finden. Ein „Aber“ in der Frage und irgendwie eine Hoffnung, dass mit der Hochzeit eine gewisse Beständigkeit in einem unbeständigen Leben einkehrt.
Die Überzeugung, es auch allein zu können, führt zum Bruch zwischen dem Du und dem Ich. Letzteres fährt ganz selbstsicher alles an die Wand, lässt im Track wunderschön die Beziehung in Flammen aufgehen. Gleich zu Beginn die Zeile „Ich scheiß auf uns“, dann „was für ‚Tod uns scheidet‘“, denn auch in der Beziehung fühlt sich das lyrische Ich erdrückt. Warum wird aus lass es gehen mit Max Raabe klar. Die Vorstellung, dass alles bleibt, wie es ist, engt das Ich so sehr ein, dass er lieber loslassen möchte, bevor es zu spät ist, bevor es ihn „quält“. Der letzte Track dein dudenkstsoschön ist schließlich eine viel zu späte Liebeserklärung. Es liege an ihm, nicht an ihr. Immerhin da liegt er richtig.
Woran es scheitert
Welches Bild einer Beziehung wird hier eigentlich vermittelt? Ist eine Freundin die einzige Möglichkeit, die (hetero-) Männer der Gen Z sehen, um sich emotional zu öffnen, „aufzutauen“? Gerade in Zeiten, in denen auf Social-Media irgendwelche Alpha-Males verbreiten, dass jedem Mann eine Frau zusteht, dass Männer „im Stillen leiden“ und ach so stark sein müssen, scheitern viele Beziehungen (die vielleicht auch einfach aus den falschen Gründen begonnen wurden) an der Angst davor, sich den eigenen Gefühlen zu stellen. Und nicht an der Angst vor einem statischen Leben. In den Texten gibt’s eine Diskrepanz zwischen Partys und Drogen und dem „geregelten Leben“, dass in einer Hochzeit gesucht wird. Letztlich ist der kurze Rausch dem Ich wichtiger, als sich den eigenen Gefühlen zu stellen (oder wie Zartmann singt: „bin ein verfluchter Hedonist“).
Mit tau mich auf sieht das Ich ein, dass er emotional nicht verfügbar ist und reproduziert hier ein Bild einer Beziehung, die vor allem den Zweck hat, einen Raum für die eigenen Emotionen zu finden, die an anderer Stelle nicht geäußert werden können. Neben einer klaren Aussprache von Texten (es klingt nicht softer, wenn alles genuschelt ist) fehlt dem Album, diese Vorstellung zu überwinden. Die Schmerzen werden, nach der Einsicht wirklich geliebt zu haben, einfach weiter sorgfältig verpackt und dabei nicht erkannt, dass Partys und Drogen kein Ersatz sind für eine emotionale Offenheit, die nicht nur in romantischen Beziehungen wichtig ist.
Kritische Außeinandersetzung mit seinem patriarchalen Männerbild? Fehlanzeige
Abgesehen davon, was Zartmanns Intention für die EP war, hat er ein Werk geschaffen, dass sich perfekt einfügen lässt in den Diskurs um ein modernes Männerbild, außerhalb von patriarchalen Stereotypen. Sein Album bildet diese nämlich optimal ab, wobei es zu keiner echten kritischen Auseinandersetzung damit kommt. Zumindest zeigt die EP, dass sich die romantisierte Vorstellung einer heteronormativen Beziehung nicht einlösen lässt. Aber das patriarchale Bild von Männern, die keine Gefühle zeigen, wird nicht überwunden. In Schönhauser stellt das Ich passend fest: „Reden tut scheinbar nicht gut. Viel gesagt, doch hör’n nie zu“. Zuhören wäre eventuell die richtige Idee gewesen, um eine gesunde Beziehung zu führen, dann tut auch Reden gut.
Stattdessen werden die männlichen Anforderungen an eine Beziehung (die nicht erfüllt werden können) in catchy Liebeslieder verpackt, die vom Großteil des Publikums wohl nicht weiter hinterfragt werden. Vielleicht sollten wir den Anlass aber nutzen, um darüber zu sprechen, wer die emotionale Arbeit in Beziehungen leistet, wie emanzipierte Partnerschaften aussehen können und mit welcher Erwartung Mann an die Sache herangeht (und ob Texte nicht vollständig ausgesprochen werden dürfen).