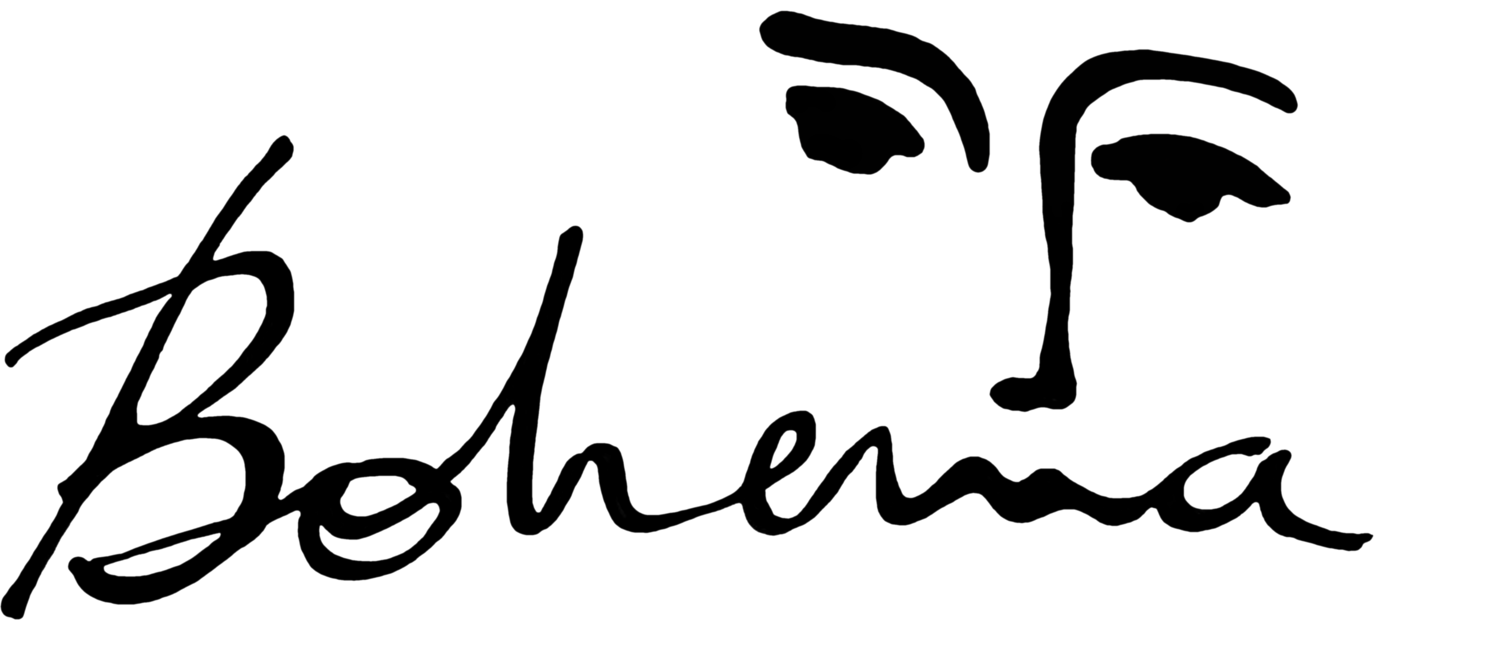Zwischen Schmerz und Shitstorm: Adichie kehrt zurück
Nach 12 Jahren Pause hat die populäre Feministin Chimamanda Ngozi Adichie im März wieder einen Roman veröffentlicht. In Dream Count rechnet der nigerianische Literaturstar mit der scheinheiligen amerikanischen Linken ab.
Chimamanda Ngozi Adichie /// © S. Fischer Verlage
Vier Frauen, vier Lebenswege
Auf den ersten Blick geht es in Chimamanda Ngozi Adichies neuem Roman Dream Count um die Liebe und vier Frauen, die danach suchen, aber an den Unzulänglichkeiten ihrer auserwählten Männer scheitern. Chiamaka, eine Reiseschriftstellerin aus Nigeria, die in Amerika lebt, sehnt sich danach, einmal wirklich gekannt zu werden, ohne dieses Gefühl jemals zu erreichen. „I have always longed to be known, truly known, by another human being.” Der erste Satz des Buches ist Programm. Zikora, ihre beste Freundin und erfolgreiche Anwältin, wünscht sich eine traditionelle Ehe und Kinder, wird aber in dem Moment von ihrem Partner verlassen, als sie ihm freudig ihre Schwangerschaft verkündet. Kadiatou, Chiamakas Haushälterin, folgt ihrerseits ihrem Verlobten von Ghana nach Amerika, doch er landet wegen Drogenbesitzes im Gefängnis und sie muss sich von nun an allein um ihre Tochter kümmern. Und Omelogor, Chiamakas beeindruckende Cousine, hat durch ihre geldwäscherische Arbeit in der Bank allen Respekt für Männer verloren und kommt nie über kurze Affären hinaus. Sie ist die einzige Protagonistin, die damit auch relativ zufrieden zu sein scheint.
Doch wie alle von Adichies Romanen ist auch dieser neueste vielschichtig und behandelt wie nebenbei eine ganze Reihe weiterer Themen. Spätestens bei der detaillierten Beschreibung der Geburt von Zikoras Sohn wird klar, dass eines hier ganz besonders präsent ist: die spezifischen Schmerzen eines Körpers mit Uterus. Adichie erzählt von Schwangerschaft, Geburt, dem Ticken der biologischen Uhr, Endometriose, Menstruationsschmerzen, Fehlgeburten, Abtreibungen, weiblicher Genitalverstümmelung und Vergewaltigung. All das einfühlsam, aber auch grafisch und sehr erlebbar, als würde sie Menschen, die diese Schmerzen nicht durchmachen müssen, beibringen wollen, wie sie sich anfühlen. Und an dieser Stelle wird man etwas stutzig.
„My feeling is trans women are trans women.“
2017 löste Chimamanda Ngozi Adichie eine Kontroverse aus: in einem Channel 4 Interview über Feminismus antwortete sie auf die Frage, ob trans Frauen Frauen seien, mit der Aussage: „My feeling is trans women are trans women.“ Daraufhin wurde ihr Transphobie vorgeworfen, da ihre Aussage impliziert, dass der Unterschied, der zwischen cis und trans Frauen existiert, relevant für ihre Inklusion in feministische Maßnahmen ist und ihre Exklusion aus diesen Maßnahmen rechtfertigt. Dadurch wird der generellen Marginalisierung von trans Frauen Tür und Tor geöffnet. Ein Facebook-Post, den sie drei Tage nach dem Interview als Antwort auf die Kritik ihrer Aussage veröffentlichte, zementierte diesen Eindruck noch. Über die nächsten Jahre setzte sich die Kontroverse fort, Chimamanda Ngozi Adichie zog für ihre Aussagen immer wieder Kritik auf sich. Als J.K. Rowling 2020 ihren lautstark als transphob kritisierten Essay „J.K. Rowling Writes about Her Reasons for Speaking out on Sex and Gender Issues“ veröffentlichte, aus dem klar hervorgeht, wie bedroht diese sich von trans Frauen fühlt, bezeichnete Chimamanda Ngozi Adichie ihn als ein „perfectly reasonable piece“. Mit der nichtbinären nigerianischen Schriftsteller*in Akwaeke Emezi, welche*r ihre Aussagen zu trans Frauen kritisierte, lieferte sie sich eine Social-Media-Fehde und veröffentlichte 2021 in Bezug darauf den Essay „It is obscene. A true reflection in three parts“, in dem sie sich verteidigte und die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien kritisierte: „There are many social-media-savvy people who are choking on sanctimony and lacking in compassion, who can fluidly pontificate on Twitter about kindness but are unable to actually show kindness.”
Diese “people who are choking on sanctimony” sind auch in Dream Count reichlich vertreten. Etwa als Chiamakas Freund Darnell, einem Kunsthistoriker, der sich selbst als linker Akademiker versteht und alle und alles „problematic“ findet, gleichzeitig aber die Menschen um ihn herum komplett empathielos behandelt, allen voran Chiamaka. Oder in Omelogors Studienkolleg*innen in Amerika, die jede ehrliche Diskussion verhindern, indem sie darüber urteilen, wer wie über was sprechen darf, statt über das tatsächliche Thema zu diskutieren. Nicht sehr subtil ist hier der alte Streit um Political Correctness und Cancel Culture ein wichtiges Thema des Buches.
Fehlende Empathie kann man Chimamanda Ngozi Adichies Schreibstil auf jeden Fall nicht vorwerfen. Die vier Frauen, aus deren Perspektiven sie ihre Geschichte erzählt, sind nicht immer sympathisch, aber ihre Gefühlswelt wird mit einem solchen Einfühlungsvermögen beschrieben, dass man sie trotz persönlicher Differenzen sehr gut verstehen und ihre Einstellungen nachvollziehen kann. Chiamaka ist beispielsweise zwar etwas nervig mit ihren Beschwerden darüber, was das Reich- und Schön-Sein mit sich bringt. Gleichzeitig versteht man aber ihren Ärger darüber, für den Reichtum ihrer Eltern, für den sie nichts kann, moralisch verurteilt zu werden, oder ihre Traurigkeit darüber, dass ihre Schönheit oft als ihre einzige relevante Eigenschaft und Leistung betrachtet wird.
Künstlerin und Werk trennen?
Vor diesem Hintergrund scheint es sehr naheliegend, Dream Count als Antwort Chimamanda Ngozi Adichies auf ihre Erlebnisse im Internet der letzten Jahre zu betrachten. Es wirkt, als wollte sie ihren Leser*innen einerseits die Empathielosigkeit der amerikanischen Linken begreiflich machen. Andererseits wird auch ihre Meinung, dass der Unterschied zwischen trans Frauen und cis Frauen relevant für den Feminismus sei, anhand der vielen geschlechtsspezifischen körperlichen Erfahrungen, die ihre Protagonistinnen durchleben, illustriert. Sie möchte möglicherweise das Mitgefühl hervorrufen, das ihr im Internet nicht gewährt wurde.
Die Anfeindungen, die Adichie erlebt hat, gingen weit über eine bloße Kritik ihrer Aussagen hinaus, und das Anprangern ist gerechtfertigt. Allerdings muss es auch möglich sein, Aussagen, die transphob sind, als solche zu bezeichnen, ohne dass dies gleich als vernichtendes Urteil wahrgenommen wird. Vor allem aus Adichies Facebook-Post geht hervor, dass sie sich davon angegriffen fühlte, als transphob bezeichnet worden zu sein, sie zeigte aber kein Verständnis dafür, warum ihre Aussagen als schädlich für trans Frauen ausgelegt werden können. Am Ende des Tages ist das Wort „transphob“ keine Beleidigung, sondern beschreibt ein bestimmtes Verhalten, und Chimamanda Ngozi Adichie hat dieses Verhalten an den Tag gelegt. Die Künstlerin vom Werk zu trennen, fällt deshalb in diesem Fall besonders schwer. Trotzdem wäre es alles in allem zu kurz gegriffen, den Roman als bloße Überzeugungsarbeit zu betrachten. Er ist auch lehrreich, berührend, unterhaltsam und trotz Einwänden auf jeden Fall lesenswert.